| |
|
|
| |
|
Gerüste müssen im
Anwendungsbereich der RSA 21 ähnlich wie
Straßenbaustellen abgesichert werden, daher in der Regel
mit Absperrschrankengittern bzw. Absperrschranken, Warnleuchten und Leitbaken
(letztere allerdings nur auf der Fahrbahn). Die Auswahl und der Einsatz
dieser Einrichtungen (insbesondere deren Montage)
erfolgt in der Praxis mit einer geradezu bemerkenswerten
Kreativität. Eine einheitliche Verfahrensweise ist nicht
erkennbar - teilweise nicht einmal im
Zuständigkeitsbereich ein und derselben Behörde. Im Rahmen dieses
Artikels werden typische Fehler
besprochen und Hinweise für eine fachgerechte Absperrung
von Gerüsten gegeben. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Gerüststellung in der
Praxis. Am anderen Ende des Gerüstes (etwa auf Höhe des
Radfahrers) verbleiben vom Gehweg nur noch etwa 40cm, so
dass nicht nur Fußgänger, sondern insbesondere Personen
mit Rollstuhl, Rollator und Kinderwagen auf die Fahrbahn
ausweichen müssen. Situationen wie diese sind an der
Tagesordnung, da die jeweiligen Anforderungen
(verkehrsrechtlich und baupraktisch) meist von allen
Beteiligten (auch Behörden) verkannt bzw. ignoriert
werden. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Kreative "Absicherung" eines Gerüstes
in der Praxis - in dieser Form natürlich kein
Einzelfall. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Behördliche Genehmigung
Behördliche Genehmigung
Grundsätzlich muss jede
Gerüststellung im öffentlichen Verkehrsraum beantragt bzw.
behördlich genehmigt werden. Die notwendige Auskunft erteilt in
der Regel die zuständige Straßenverkehrsbehörde bzw. das
Ordnungsamt. Eine fehlende Genehmigung kann insbesondere im
Zusammenhang mit einem Unfall erhebliche Probleme mit sich
bringen - nicht nur für den Auftraggeber bzw. Bauherrn / Gerüstnutzer,
sondern in besonderen Fällen auch für den Gerüstersteller.
Zur Anwendung kommt in der Regel
eine Ausnahmegenehmigung nach §46 Abs. 1 Nr. 8 StVO, bzw. eine
Sondernutzungserlaubnis für öffentliche Verkehrsflächen (dazu
zählen auch Geh- und Radwege sowie Fußgängerzonen), womit die
Hindernisbereitung bzw. Nutzung über den Gemeingebrauch hinaus
gestattet wird. Diese Erlaubnis wird üblicherweise mit Auflagen
zur fachgerechten Absperrung des Gerüstes einhergehen, wodurch
sich letztendlich die Notwendigkeit für eine verkehrsrechtliche
Anordnung nach §45 Abs. 6 StVO ergibt. Dies gilt gleichermaßen
für die Aufstellung von Haltverboten, um z.B. die Montage bzw.
Demontage des Gerüstes zu gewährleisten.
Die Genehmigung kann allein zum
Zweck der Gerüststellung erfolgen, aber auch im Zuge einer
anderen verkehrsrechtlichen Anordnung erteilt werden (z.B. Hilfsgerüst als
Kabelüberführung im Rahmen von Baumaßnahmen).
Grundsätzlich gilt, dass mit dem notwendigen Aufstellen von
Absperrgeräten bzw. Verkehrseinrichtungen nach §43 StVO bzw.
Anlage 4 StVO (Absperrschranken, Absperrschrankengitter, Leitbaken usw.)
immer eine verkehrsrechtliche Anordnung verknüpft ist.
Eigenmächtig dürfen diese Einrichtungen nicht aufgestellt bzw.
angebracht werden.
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
 Gerüstmontage mit einplanen
Gerüstmontage mit einplanen
Besonderes Augenmerk gilt den
Montagearbeiten zur Stellung des Gerüstes, denn hierfür werden in der Regel zusätzliche
Flächen im öffentlichen Verkehrsraum beansprucht (z.B. für Fahrzeuge,
temporäre Materiallagerungen auf Gehwegen usw.) und es werden Lasten im Luftraum neben bzw. über
diesen Verkehrsflächen bewegt (teilweise auch mittels
Schrägaufzug usw.). In der behördlichen Genehmigungspraxis
spielen diese Vorgänge üblicherweise gar keine Rolle, obwohl
hiervon nicht selten eine deutlich größere Gefahr ausgeht, als vom fertigen
Gerüst. Jede Gerüststellung erfordert daher auch sorgfältige Überlegungen
hinsichtlich der Absicherung von Anlieferung, sowie Auf- Um-
und Abbau. Die verkehrsrechtliche Anordnung darf daher nicht nur
das fertig aufgebaute Gerüst umfassen, sondern muss auch
Verkehrssicherungsmaßnahmen für die Montage definieren. Entsprechende Negativ-Beispiele finden sich am Ende dieses Artikels.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Gerüststellung auf Geh- und Radwegen sowie in Fußgängerzonen
Gerüststellung auf Geh- und Radwegen sowie in Fußgängerzonen
Wie die Absicherung
von Gerüsten vorgenommen wird,
ist natürlich vom konkreten Einzelfall abhängig. Neben der bloßen
Sicherung des Hindernisses durch Absperrgeräte und
Warnleuchten, können auch ergänzende
Maßnahmen wie z.B. die Errichtung eines
Fußgängernotweges auf der Fahrbahn erforderlich sein. Die nachfolgenden
Beispiele behandeln daher Mindestanforderungen, die an die jeweilige Örtlichkeit angepasst werden
müssen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Absicherung mit Absperrschrankengittern (Regelfall)
Absicherung mit Absperrschrankengittern (Regelfall)
Die RSA 21 enthalten wenig Konkretes zum
Thema Gerüststellung und auch in diesem Fall sind leider
Widersprüche vorhanden. So werden im Teil A in der Tabelle A-3
bezüglich der Kennzeichnung von Gerüsten, Durchlaufgerüsten und
Fußgängertunneln kleine Leitbaken (12,5x50cm) benannt, obwohl Leitbaken
gemäß Teil A, Abschnitt 3.4.3 Absatz 4 auf Gehwegen nicht
zulässig sind. Der Verweis auf kleine Leitbaken widerspricht
zudem der Darstellung des
Portalrahmens im Regelplan B II/10, denn hier kommen sowohl
vertikal, als auch horizontal Absperrschranken zur Anwendung. So
wie im Regelplan B II/10 dargestellt ist die Ausführung auch korrekt - die entsprechende Vorgabe
in der Tabelle A-3 sollte man also nicht weiter beachten.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass
Gerüste Arbeitsstellen im Sinne der RSA 21 darstellen und folglich
vor allem im Geh- und Radwegbereich mit
Absperrschrankengittern abzusichern sind. Hierdurch ergeben sich
einige Probleme hinsichtlich einer fachgerechten
Realisierung, da weder die Gerüstbranche, noch die Hersteller
von Absperrgeräten diese
Anforderung auf dem Schirm haben.
Absperrschrankengitter stellen gemäß
RSA 21 das
Standardelement zur Absicherung auf Geh- und Radwegen dar und
hierbei ist vor allem die konstruktiv vorhandene Blindentastleiste
im unteren Bereich von Bedeutung. Deren Funktion muss im Sinne der Anforderungen von
sehbehinderten und blinden Menschen sowohl an der Stirnseite
eines Gerüstes, als auch in Längsrichtung vorhanden sein. Dies
lässt sich in vielen Fällen zwar auch mit Gerüstbau-Material
realisieren, stellt dann aber eine rein bauliche Einrichtung dar, die
in dieser Form nicht angeordnet bzw. eingefordert werden kann. Die
Verkehrsbehörde darf auf Geh- und Radwegen nur
Absperrschranken- bzw. Absperrschrankengitter vorschreiben -
Gerüstrohre oder Bordbretter hingegen nicht.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Absperrung der Stirnseite / Querabsperrung:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 |
|
 |
|
Beispiel für die Absicherung der
Stirnseite eines Standardgerüstes. Das gezeigte
Absperrschrankengitter mit einer Baubreite von etwa 0,80m ist
bislang nicht im Handel erhältlich, da die Industrie diese
Anforderung noch nicht erkannt hat und in
diesem Bereich auch wenig innovativ ist (Stand April 2023). |
|
Der Wandabstand von Gerüsten kann
auch breitere Absperrschrankengitter erfordern - wie in diesem
Fall 1,20m. Diese Baugröße bieten einige Hersteller sogar an.
Das Schrägstellen eines Standard-Absperrschrankengitters (2,0m
Länge) ist u.a. auf Grund der reduzierten Retroreflexion nicht
sinnvoll. |
|
|
| |
|
|
| |
|
Gemäß RSA 21 müssen
Absperrschrankengitter als Querabsperrung der
Retroreflexionsklasse RA2 entsprechen (auch auf Geh- und
Radwegen). Als Warnleuchten sind auf Geh- und Radwegen
ausschließlich Rundstrahler vom Typ WL8 vorgesehen. Deren Querabstand darf max.
1m betragen, wobei in der rechten Abbildung ggf. auch nur eine
Leuchte (links außen) ausreichend ist. Die Entscheidung hierzu
trifft wie üblich die anordnende Behörde. Bei größeren
Sperrbreiten (z.B. vorgesetzte Podesttreppentürme oder
zusätzlicher Platz für Materiallagerungen / BE-Flächen) müssen die
definierten Querabstände aber eingehalten werden.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Absperrung in Längsrichtung:
|
|
|
| |
|
|
| |
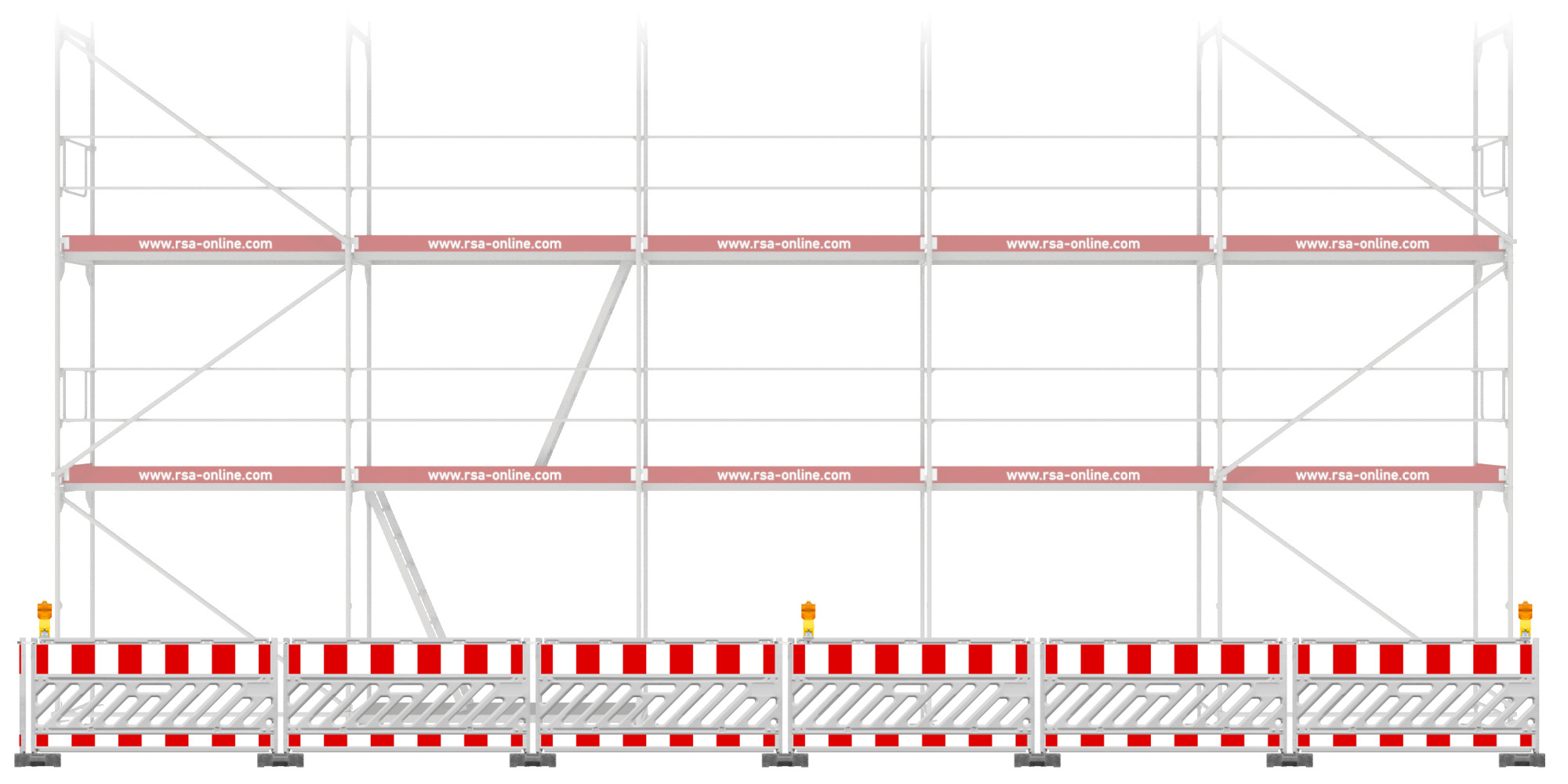 |
|
| |
|
Auch die Längsabsperrung eines
Gerüstes wird im Regelfall mit Absperrschrankengittern
realisiert. In dieser Funktion kann die Retroreflexionsklasse
RA1 ausreichend sein (RSA 21 Teil A, Abschnitt 3.4.1 Absatz 4
letzter Satz). Die Beschaffung bzw. der Einsatz
unterschiedlicher Varianten wird aber auf Grund der
Verwechslungsgefahr nicht empfohlen. Daher ist auch in
Längsrichtung von Absperrschrankengittern der
Retroreflexionsklasse RA2 auszugehen - zumal die zuständige
Behörde zwar Gitter der Klasse RA1 zulassen kann, sie muss es
aber nicht.
Auch in Längsrichtung sind auf Geh-
und Radwegen Rundstrahler von Typ WL8 vorgesehen, wobei der
Längsabstand in diesem Fall max. 9m betragen darf.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Unterbrechungen, z.B. im Bereich von Haus-
bzw. Geschäftseingängen usw., werden wie abgebildet realisiert,
wobei die dortigen Stirnseiten wieder nach dem oben gezeigten
Beispielen abzusichern sind. In dieser Grafik wurden auch 1,60m
lange Absperrschrankengitter eingesetzt, die aber in der Praxis
nur selten vorhanden sind. Natürlich könnte man auch einfach 2,00m lange
Standard-Absperrschrankengitter versetzt hintereinander
aufstellen - professionell ist das allerdings nicht. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Beispiel für die Absicherung
eines Gerüstes mit Absperrschrankengittern und
Fußplatten. Anstelle der Fußplatten können auch
Bauzaunfüße eingesetzt werden. |
|
|
| |
|
|
| |
|
Vor allem in Längsrichtung besteht
das Problem, dass Absperrschrankengitter nicht zum
standardisierten Gerüst-Rastermaß passen. Daher kann und wird es
passieren, dass eine Fußplatte genau dort aufgestellt werden
muss, wo sich eine Gerüstspindel befindet. Mögliche
Improvisationen mit Rödeldraht, Klebeband oder Kabelbindern
(anstelle der Fußplatten) werden dann nicht lange auf sich
warten lassen.
Es bleibt zu hoffen, dass die
Hersteller von Absperrgeräten auch schmalere Varianten anbieten,
um für die Besonderheiten des Gerüstbaus eine Lösung anzubieten. Ebenfalls wäre es sachgerecht, wenn passendes Gerüstbau-Zubehör
entwickelt wird, dass eine - professionelle - Aufstellung bzw.
Montage von
Absperrschrankengittern auch ohne Fußplatten ermöglicht. Die
klassische Drehkupplung ist damit natürlich nicht gemeint ;-) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
Absicherung mit speziellen Gerüst-Absperrschranken
Wie beschrieben besteht die Regellösung zur
Absicherung von Gerüsten vor allem im Geh- und Radwegbereich aus
Absperrschrankengittern. Die Industrie hat jedoch bereits vor
einigen Jahren systemspezifische Absperrgeräte speziell für
Gerüste entwickelt, die in diesem Artikel auch weiterhin
beschrieben werden. Im Gegensatz zu
Absperrschrankengittern sind die speziellen Gerüstabsperrungen
im Standardraster erhältlich, so dass die beschriebene
Problematik der Fußplatten entfällt. Zudem kann der Platzbedarf
für die Absicherung insgesamt reduziert werden (Mindestbreite
der Verkehrswege in Längsrichtung). Ein Problem stellt
allerdings die fachgerechte Montage der zusätzlich
erforderlichen Blindentastleisten (Unterkante max. 15cm) dar,
da sich in diesem Bereich die Gerüstspindeln befinden.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Systemspezifische Absperrschranken,
ausgestattet mit Reflexfolie der Klasse
RA2, Bauhöhe mind. 10cm, eingesetzt als Quer- und Längsabsperrung.
Die Oberkante von Absperrschranken soll sich gemäß RSA in 1,00m Höhe über dem Gehweg
befinden. Lässt sich dies nicht gewährleisten
(abhängig von der Ausspindelung der Füße, z.B. zum
Geländeausgleich), ist die Montage zusätzlicher
Geländerkästchen bzw. Kippstifthalterungen usw.
erforderlich. |
|
|
| |
|
|
| |
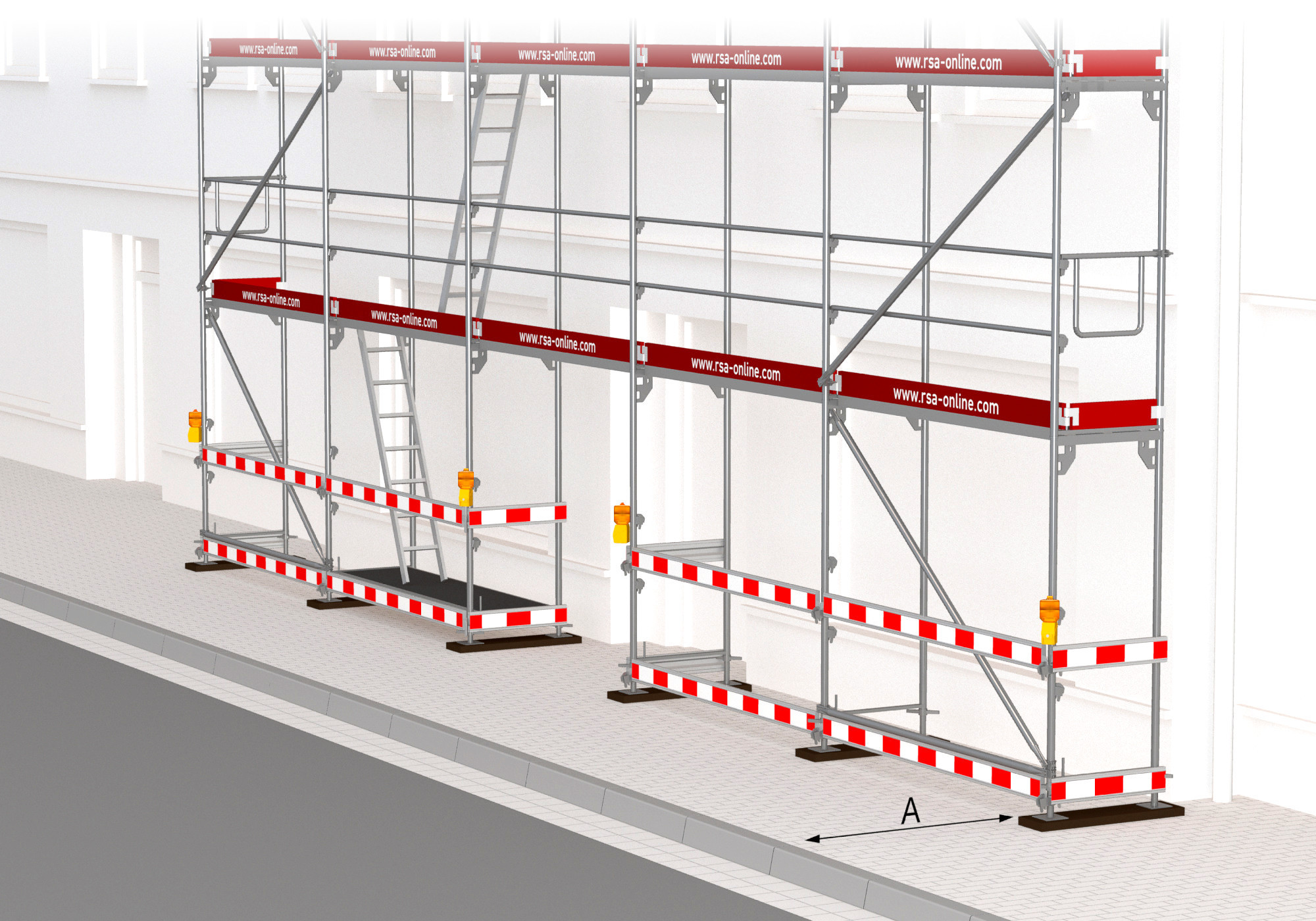 |
|
| |
|
So würde die zusätzliche
Anbringung von Blinden-Tastleisten in Bodennähe
(Unterkante max. 15cm) aussehen. Wie beschrieben dürfte
die konstruktive Realisierung im Bereich der Fußspindeln
nicht ganz unproblematisch sein, aber
vielleicht werden auch hierzu noch praxistaugliche
Lösungen entwickelt. Als "Lückenschluss" zwischen der
oberen und unteren Absperrschranke können z.B.
Gerüst-Netze genutzt werden, die hierzu natürlich
dahinter angebracht werden müssen, um das
Verkehrszeichenbild nicht zu verdecken. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Mindestbreite (A)
Mindestbreite (A)
Die Mindestbreite der verbleibenden
Verkehrsfläche ist ein wesentliches Kriterium zur
Absicherung bzw. konstruktiven Ausführung von Gerüsten
(insbesondere beim Erfordernis eines Durchgangsgerüstes
bzw. Fußgängertunnels). Es ist deshalb von wesentlicher
Bedeutung, dass sich alle Beteiligten im Vorfeld darüber
verständigen, wie der oftmals notwendige Kompromiss aus
Verkehrssicherheit und baupraktischen Erfordernissen
aussehen muss.
Folgende Werte sind in den RSA 21 definiert: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Mindestbreite gemäß RSA
21 |
RSA
95 |
|
|
|
Gehweg |
1,30m
(bei kurzen Engstellen 1,00m) |
1,00m |
|
|
|
Gehweg,
Radverkehr frei |
1,50m
(bei kurzen Engstellen 1,30m) |
- |
|
|
|
Radweg |
1,50m
(bei kurzen Engstellen 1,30m) |
0,80m |
|
|
|
gemeinsamer Geh- und Radweg |
2,50m
(im Ausnahmefall 2,00m) |
1,60m |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Was "kurze Engstellen" sind,
ist genau so wenig beschrieben, wie der "Ausnahmefall" bei
gemeinsamen Geh- und Radwegen. Die Entscheidung obliegt
auch in diesem Fall der anordnenden Behörde, die hierzu
die örtlichen Besonderheiten im Blick haben muss. Für
die sachgerechte Bewertung ist es natürlich wichtig, dass der Antragsteller den
tatsächlich erforderlichen Platzbedarf kennt
(einschließlich Absperrung) und gegenüber der Behörde
konkrete Angaben macht. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Hier verringert sich die
verbleibende Gehweg-Restbreite von ca. 1,10m (vorn) auf
0,40m (hinten). Im Anwendungsbereich der RSA 21 wird an
solchen Stellen ein Fußgängernotweg auf der Fahrbahn
einzurichten sein, damit Fußgänger und insbesondere
Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen ihren
Weg auf derselben Straßenseite fortsetzen können.
Natürlich resultiert daraus eine erhebliche
Einschränkung des fließenden Verkehrs auf der Fahrbahn,
da diese zur Realisierung des Fußgängernotweges
halbseitig gesperrt werden muss. Auf Grund der
vorhandenen Kurve wird dann ggf. der Einsatz einer
Lichtzeichenanlage erforderlich. Der Aufwand und die
Kosten hierfür können die der eigentlichen Baumaßnahme
problemlos übersteigen - dies ist allerdings die
Konsequenz aus einer deutlich veränderten Gewichtung der
Interessen schwächerer Verkehrsteilnehmer im
Anwendungsbereich der RSA 21. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Situation am anderen Ende
des Gerüstes. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Bei der Bemessung der
Mindestbreite sind natürlich auch die erforderlichen
BE-Flächen zu berücksichtigen - wobei es natürlich in
erster Linie Sache des Antragstellers ist, der
anordnenden Behörde die erforderlichen Informationen
zuzuarbeiten. Da die Antragsteller ihren tatsächlichen
Platzbedarf aber nicht immer korrekt einschätzen
(wollen), oder über Situationen wie im Bild gekonnt
hinwegsehen ("ist doch nur für zwei Tage"),
empfiehlt sich ein gezieltes Nachfragen seitens der
Behörde. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Platzbedarf für vorgesetzte Podesttreppentürme - TRBS
2121 Teil 1
Platzbedarf für vorgesetzte Podesttreppentürme - TRBS
2121 Teil 1
Die Verschärfung der
Arbeitsschutzvorschriften im Bereich Gerüstbau bzw.
Gerüstnutzung, erfordert in der Regel die Errichtung von
Treppenaufgängen ab einer Aufstiegshöhe von 5m
(ausgenommen sind Arbeiten an Einfamilienhäusern). Der Zugang
über innenliegende Leitern ist nur bis zu dieser Höhe
zulässig und soll zudem auch bei geringeren
Aufstiegshöhen möglichst vermieden werden. Den Vorzug
erhalten Aufzüge, Transportbühnen und Treppen.
Detaillierte Informationen zu dieser Thematik finden
sich in der aktuellen Fassung der TRBS 2121 Teil 1.
Die Änderung hat zur Folge,
dass bei vielen Gerüsten nunmehr vorgesetzte
Podesttreppentürme zu errichten sind, was natürlich
erhebliche Auswirkungen auf die verbleibende Mindestbreite der
jeweiligen Verkehrsfläche hat. Bereits in der
Planungsphase muss dieser Bedarf erkannt werden, so dass
die Notwendigkeit eines vorgesetzten Treppenturmes bei
der Beantragung der Stellgenehmigung bzw. der
verkehrsrechtlichen Anordnung berücksichtigt werden
kann. |
|
|
| |
|
|
| |
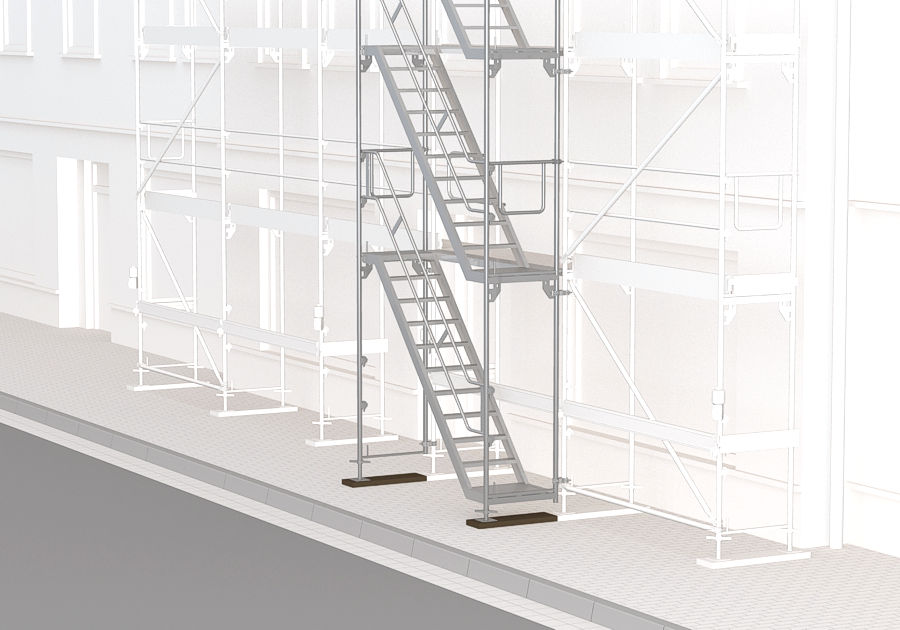 |
|
| |
|
Prinzipdarstellung eines vorgesetzten Treppenturmes. Die Grafik (bewusst
ohne Darstellung einer möglichen Absicherung)
verdeutlicht den zusätzlichen Platzbedarf bei Verwendung
einer gleichläufigen Treppenanordnung (mind. doppelte
Gerüstbreite). Im Falle einer gegenläufigen
Treppenanordnung ist sogar die dreifache Gerüstbreite
erforderlich (jeweils bezogen auf 73er Stellrahmen).
Dort wo bisher ein Platzbedarf von etwa 1,10m
erforderlich war (inkl. Wandabstand), summiert sich die
erforderliche Breite auf etwa 1,90m (gleichläufige
Treppen) bzw. 2,70m (gegenläufige Treppen). Alle Maße
sind natürlich nur Beispiele und werden in der Praxis
meist größer ausfallen (z.B. Verwendung von
Distanzkupplungen usw.). |
|
|
| |
|
|
| |
|
Fußgängernotweg oder optimierter Aufbau
Hinsichtlich der notwendigen Absperrung
des oben dargestellten Beispiels, wird die Lösung in einem Fußgängernotweg auf der Fahrbahn bestehen. In
Abstimmung mit den Arbeitsschutzanforderungen wäre es
allerdings im Einzelfall auch denkbar, den Aufstieg in
der ersten Gerüstlage mittels innenliegender Leiter
(ggf. auch Treppe an geeigneter Stelle) zu realisieren
und die erste Lage des Treppenturmes (ohne Treppe) als
Durchgangsgerüst auszuführen. Erst ab der zweiten
Gerüstlage wird dann der eigentliche Treppenturm
begonnen. Hierdurch kann die vollständige Blockierung
des Gehweges vermieden werden. Das Beispiel Treppenturm
zeigt, dass der Konflikt zwischen Arbeitsschutz und
Verkehrssicherheit auch im Falle der Gerüststellung
gegeben ist. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Vorgesetzter Treppenturm in
der Praxis, wobei die erforderliche Gehweg-Mindestbreite
in diesem Fall gewährleistet ist. Auf schmaleren
Gehwegen funktioniert das selbstverständlich nicht. Die Absicherung
eines Podesttreppenturmes erfolgt gemäß RSA 21 nicht mit Leitbaken und
schon gar nicht mit roten Warnleuchten, sondern mit
Absperrschrankengittern und gelben Rundstrahlern vom Typ WL8.
Podesttreppentürme sind ebenfalls ein typischer
Anwendungsfall für die vorgestellten
80cm-Absperrschrankengitter, welche die Industrie
bislang nicht anbietet. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Absicherung Durchgangsgerüst bzw. Fußgängerschutztunnel
Absicherung Durchgangsgerüst bzw. Fußgängerschutztunnel
|
|
|
|
|
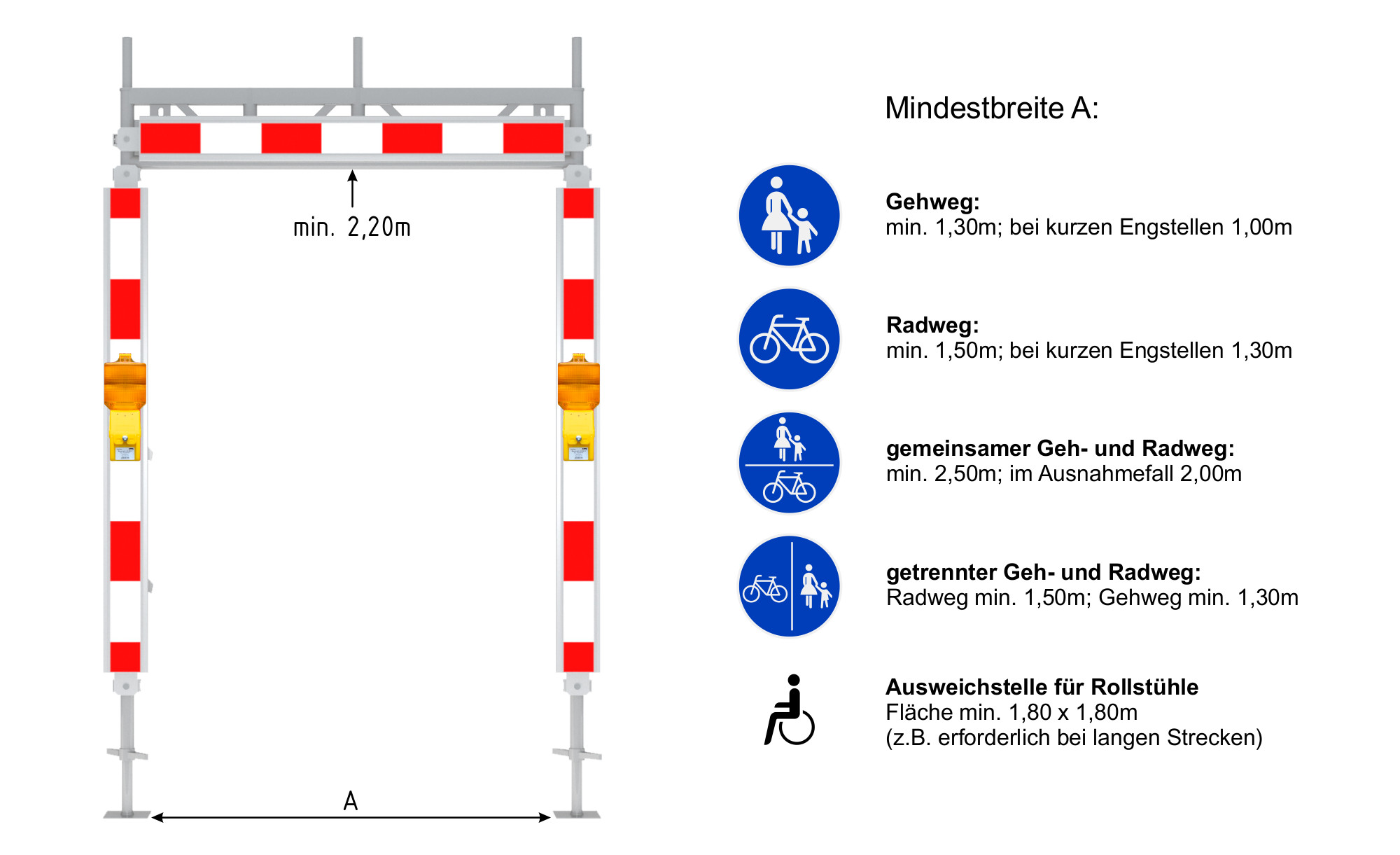 |
|
|
|
|
Portalkennzeichnung: Die
Absicherung der Portale
eines Durchgangsgerüstes (auch Fußgängerschutzgang bzw.
-tunnel) erfolgt durch horizontal und
vertikal angebrachte Absperrschranken (Reflexfolie mind.
RA2, Bauhöhe mind.
10cm). Die lichte Höhe des Durchgangs beträgt an
allen Stellen mindestens 2,20m (auch
auf Gehwegen). Bei der Verwendung von fertigen
Durchgangsrahmen ist daher - zusätzlich zum
geländespezifischen Höhenausgleich - eine entsprechende Ausspindelung der Füße erforderlich, was ggf.
Auswirkungen auf die Wahl der jeweiligen Fußspindeln hat
(konstruktive Anforderungen / Statik beachten!). Bezüglich der Mindestbreite (A)
gelten die dargestellten Werte - im Falle eines
Gehweges also z.B. 1,30m, was bei
Standard-Durchgangsrahmen üblicherweise gewährleistet
ist.
Hinweis: Die
verschiedenen Auffassungen zur Zulässigkeit einer
Benutzungspflicht von Radverkehrsanlagen sind nicht
Gegenstand dieses Artikels. Es ist jedoch zu beachten,
dass die bloße Kennzeichnung der jeweiligen Wege durch
die Zeichen 237, 240 und 241 (im Sinne der
Zweckbestimmung), formell eine Benutzungspflicht
auslöst, welche wiederum über die Anwendung anderer
Kriterien (sichere Benutzbarkeit der Verkehrsanlage
usw.) ggf. nicht zulässig ist, bzw. vor Ort gar nicht
erwirkt werden soll. Entsprechend sorgsam ist die
Anordnung dieser Zeichen vorzunehmen, insbesondere mit
Blick auf die tatsächliche Situation an der jeweiligen
Örtlichkeit. |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Durchgangsgerüst auf
dem Gehweg: Systemspezifische Absperrschranken mit Reflexfolie mind.
RA2, Bauhöhe mind. 10cm, eingesetzt als Portalrahmen,
sowie an vorstehenden Stützen (Bildmitte) und als
Längsabsicherung. Wie beschrieben können fahrbahnseitig
auch Absperrschrankengitter angeordnet werden
(Regelfall). Die Kennzeichnung bei Dunkelheit
erfolgt durch
gelbe Rundstrahler-Warnleuchten vom Typ WL 8
(Dauerlicht) - Abstand in Längsrichtung max. 9m. Im
Bodenbereich sind Tastleisten (Unterkante max. 15cm) zur
Führung von Sehbehinderten und Blinden erforderlich. Im Rahmen der
verkehrsrechtlichen Anordnung müssen dies - formell
gesehen - ebenfalls
Absperrschranken (oder Absperrschrankengitter) sein, rein konstruktiv (im Sinne des
Schutzziels) genügen z.B. auch Bordbretter wie
abgebildet. Wie beschrieben sind diese aber nicht
anordnungsfähig.
Gerüstbauteile sollten im Durchgangsbereich
z.B. mit Gerüst-Gaze bis in 1,00m Höhe seitlich
verkleidet werden. Gerüstplanen bzw. -netze, Werbeplanen
usw. dürfen die
Gerüst-Absperrung nicht verdecken bzw. beeinträchtigen. Scharfkantige Teile,
Stolperstellen usw. sind zu vermeiden - ggf. ist die
Anbringung eines durchgehenden Handlaufes erforderlich.
Wird die vorhandene Straßenbeleuchtung durch das Gerüst
bzw. den Schutzgang beeinträchtigt, sind ergänzende
Beleuchtungsmaßnahmen zu treffen. Die
Rundstrahler-Warnleuchten vom Typ WL8 können diese
Funktion natürlich nicht übernehmen.
Der seitliche Sicherheitsabstand zur Fahrbahn (Bordstein)
beträgt mind. 0,50m, keinesfalls weniger als 0,30m. Können
diese Maße nicht eingehalten
werden, erfolgt eine zusätzliche Sicherung durch
Leitbaken auf der Fahrbahn. Hierbei ist wiederum die verbleibende Fahrbahn- bzw.
Fahrstreifenbreite zu beachten. Es kann in solchen
Fällen z.B. eine Verkehrsführung nach dem Prinzip von
Regelplan B I/4 erforderlich werden. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Durchgangsgerüst in der
Praxis, wobei die einzig vorhandene "Absperrung" in Form
einer Leitbake nicht nur unzweckmäßig, sondern auch
unwirksam ist. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Fotomontage:
Portalkennzeichnung mit gerüstspezifischen
Absperrschranken und gelben Rundstrahlern. Auf die
Befestigung der wehenden Gerüstplanen innerhalb des
Durchgangs wurde im Rahmen der Fotomontage verzichtet -
dies gehört in der Praxis aber ebenfalls zu einer
fachgerechten Ausführung eines solchen
Durchgangsgerüstes. Zudem kann eine zusätzliche
Beleuchtung erforderlich werden, wenn die
Straßenbeleuchtung im betroffenen Gehwegbereich nicht
mehr ausreichend ist. Eine Absicherung gegenüber der
Fahrbahn (durch Leitbaken) wird erforderlich, wenn der
30cm-Sicherheitsabstand zum Lichtraum der Fahrbahn
unterschritten wird. Die Leitbaken sind dann mit
entsprechenden Fußplatten auf der Fahrbahn aufzustellen.
Sie werden nicht am Gerüst selbst befestigt. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Materiallagerungen im Durchgangsbereich sind unzulässig
Materiallagerungen im Durchgangsbereich sind unzulässig
Der Durchgangsbereich
muss stets in voller Höhe und Breite zur Verfügung
stehen. Das hat zur Folge, dass bestimmte Arbeiten (z.B.
Fassadensanierung / Malerarbeiten) möglicherweise nicht mit Hilfe eines
Durchgangsgerüstes durchgeführt werden können. Zumindest
ist für die Zeit, in der die Verkehrsfläche zur
Durchführung der Arbeiten beansprucht wird, eine
adäquate Ersatzlösung herzustellen, was natürlich im
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden muss.
Eigenmächtige Maßnahmen (z.B. eine nicht genehmigte
Sperrung des Durchgangs) sind - auch kurzzeitig - unzulässig. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Durchgangsgerüst ohne jede
Kennzeichnung, dafür aber mit Gerüstgaze als provisorische "Absperrung".
Die fachgerechte Lösung besteht im Entfernen bzw.
Versetzen des Containers (im Bildhintergrund hinter dem
Bauzaun) zur Schaffung eines temporären Notweges im
Bereich der vorhandenen BE-Fläche. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
 Beschilderung "Gehwegwechsel"
vermeiden
Beschilderung "Gehwegwechsel"
vermeiden
Insbesondere bei räumlich eher kurzen
Einschränkungen (z.B. bei kleinen Gerüsten oder kleinen
Aufgrabungen), werden in der Praxis sehr gern die
Zusatzzeichen 1000-12 und 1000-22 aufgestellt, um
Fußgänger auf den gegenüberliegenden Gehweg zu
verweisen. In vielen Fällen werden diese
Schilder "einfach so" montiert, ohne dass sie
ausdrücklich angeordnet sind. Teilweise ist eine solche
Lösung aber auch Bestandteil der
verkehrsrechtlichen Anordnung und damit behördlich
"gewollt".
Die RSA 21 sehen dagegen vor, das
Gehwege in der Regel fortzuführen sind und das
entspricht letztendlich der Lebenswirklichkeit bzw. dem
Verhalten von Fußgängern. Diese setzen ihren Weg
natürlich auf derselben Straßenseite auf der Fahrbahn
fort (den Autor eingeschlossen). Auffassungen der
Kategorie "wir haben das ja als Gehwegwechsel
beschildert, wenn die sich nicht dran halten, sind sie
bei einem Unfall selber schuld", sind keine
Grundlage für eine verkehrsrechtlich korrekte
Ermessensentscheidung einer verantwortungsvoll
arbeitenden Verkehrsbehörde. Es darf ausdrücklich
bezweifelt werden, dass ein Gericht einer solchen
Fehleinschätzung folgt. Wenn ein kollektives
Fehlverhalten zu erwarten ist, weil die getroffene
Verkehrsregelung schlichtweg ungeeignet und absolut
lebensfremd ist, können die Folgen nicht allein den
betroffenen Verkehrsteilnehmern angelastet werden: |
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
|
In solchen und ähnlichen
Fällen muss man sich einmal
selbst die Frage stellen, ob man wirklich die Straßenseite wechseln würde (hin
und zurück versteht sich). Niemand - vom Schulkind bis
zum betagten Rentner - würde diesen Umweg freiwillig
annehmen. Stattdessen führt der direkte Weg unmittelbar
am Hindernis vorbei und damit in der Regel auf der
Fahrbahn. Das ist durchaus menschlich und kann z.B. in
gering frequentierten Wohnstraßen akzeptiert werden. An
anderen Stellen müssen die Überlegungen allerdings
etwas sorgfältiger und vor allem praxisgerecht ausfallen
- insbesondere auf Schulwegen. Keinesfalls darf eine
verkehrsrechtliche Anordnung zur Folge haben, dass
Fußgänger und Radfahrer sich quasi selbst überlassen
sind, ohne dass ihnen eine sichere (und sinnvolle)
Alternative angeboten wird. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Andere Stelle, ähnliches Prinzip: Einmal auf den gegenüberliegenden
Gehweg und nach etwa vier Metern wieder zurück - das wird hier
vom Fußgänger gefordert. Da die verbleibende Restbreite unter
Mitnutzung der Grünfläche etwa 1,00m beträgt, würde der Verzicht
auf die Zeichen
1000-12 / -22 genügen.
Allerdings sind Rasenflächen - je nach Untergrund - für
Rollstuhlfahrer ungeeignet. Anstelle der gezeigten "Lösung" wäre die Stellung eines Durchgangsgerüstes,
oder die Sperrung der beiden Parkflächen zur Schaffung eines
Notgehweges denkbar. Unabhängig von diesen Anforderungen wären
Absperrschrankengitter
anstelle der Leitbaken einzusetzen. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Diese Arbeitsstelle kennen wir
bereits vom Abschnitt zu den Mindestbreiten - die jetzt gezeigte
Situation wurde ein paar Tage später aufgenommen. Ob hier die
zuständige Verkehrsbehörde tätig geworden ist, oder ob das
Gerüstbauunternehmen bzw. der Bauherr von allein gehandelt
haben, ist unklar. Klar ist hingegen, dass es sich bei der neuen
Variante eher um eine Verschlimmbesserung handelt, als um eine
fachgerechte Lösung des vor Ort bestehenden Problems. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Entsprechend lässt das vermeintliche
Fehlverhalten der Fußgänger nicht lange auf sich warten. Und mal
ehrlich: Wer würde wegen dieser kurzen Strecke tatsächlich auf
die andere Straßenseite wechseln, wenn das eigentliche Ziel gar
nicht auf der anderen Straßenseite liegt? Situationen wie diese
sorgen letztendlich auch dafür, dass die Ignoranz der
Verkehrsteilnehmer zusätzlich gefördert wird. Entsprechend
braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn diese Ignoranz auch
dann zum Tragen kommt, wenn ein Gehwegwechsel - fachlich gesehen
- sinnvoll und begründet ist. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Hier ist eigentlich eine
ausreichende Restbreite bis zum eigentlichen Bordstein gegeben -
dennoch wurden auch in diesem Fall die Schilder zum Gehwegwechsel
angebracht. Natürlich wären anstelle der
Leitbaken Absperrschranken bzw. Absperrschrankengitter einzusetzen. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Die Königsdisziplin ist hier zu
bestaunen. Fehlt noch Werbung für das gastronomische
Tagesangebot unter Z
1000-22. Die sonstige "Absicherung" ist auch gelungen. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
 Warnleuchten an Gerüsten auf Geh- und
Radwegen
Warnleuchten an Gerüsten auf Geh- und
Radwegen
Zunächst ist es wichtig, dass Gerüste
überhaupt durch gelbe Warnleuchten ergänzt werden. Und - das muss
man leider dazu schreiben - dass diese Warnleuchten
während der Dunkelheit auch funktionieren. In der Regel
genügt im Bereich von Geh- und Radwegen die Anbringung
einer gelben Warnleuchte an der jeweiligen Stirnseite
des Gerüstes.
Sofern das Gerüst breiter als 1,0m ist, sollten
mindestens zwei Leuchten pro Stirnseite montiert
werden, bzw. so viele, dass der maximal zulässige
Querabstand von 1,0m eingehalten wird. In Längsrichtung sind Warnleuchten mindestens
alle 9m anzubringen. Dort wo sich die Breite des
Gerüstes konstruktiv ändert (z.B. vorgesetzte
Treppentürme), oder wo durch Haus- oder
Geschäftseingänge usw. neue "Stirnseiten" geschaffen werden,
sind ebenfalls Warnleuchten zu montieren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Insbesondere in
Längsrichtung besteht das Problem, dass sich
Warnleuchten vom Typ WL1 und WL2 (Richtstrahler) in der
Regel nur unzureichend auf den Verkehr ausrichten
lassen. In der Praxis werden die Leuchten oftmals so montiert,
das die Warnwirkung - je nach Produkt - komplett
verloren geht (sofern die Leuchten überhaupt
funktionieren): |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
In Längsrichtung unwirksame
Warnleuchten, bedingt durch eine vollkommen sinnfreie Montage. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
 Rundstrahler vom Typ WL8
Rundstrahler vom Typ WL8
Die beschriebenen
Defizite lassen sich mit Rundstrahler-Warnleuchten vom
Typ WL8 beheben, weshalb ausschließlich diese Leuchten
im Anwendungsbereich der RSA 21 auf Geh- und Radwegen
vorgesehen sind. Rundstrahler strahlen das Licht horizontal um
360° ab, so dass auch bei ungünstigen Montagebedingungen
immer eine hinreichende Warnwirkung gegeben ist. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Rundstrahler-Warnleuchte vom Typ WL8
gemäß TL-Warnleuchten |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Montagehöhe der Warnleuchten
Montagehöhe der Warnleuchten
Diebstahl und Vandalismus stellen im
Bereich der Verkehrssicherung ein ernsthaftes Problem
dar und insbesondere Warnleuchten sind offenbar dazu
prädestiniert, sie zu zerstören oder zu entwenden. Allein
deshalb auf die Anbringung
von Warnleuchten zu
verzichten, ist jedoch im Sinne der Vorschriften unzulässig. Entsprechend behilft
man sich in der Praxis u.a. damit, die Leuchten möglichst
hoch zu montieren, damit sie nicht "im
Vorbeigehen" beschädigt oder entfernt werden können.
Tatsächlich müssen Warnleuchten aber so montiert werden,
dass sie ihre Warnwirkung auch gegenüber der jeweiligen
Verkehrsart entfalten können. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Verkehrszeichen zu niedrig,
Warnleuchte zu hoch. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Gerüststellung auf der Fahrbahn
Gerüststellung auf der Fahrbahn
Die Gerüststellung unmittelbar neben der Fahrbahn
(z.B. auf schmalen Gehwegen) bzw. direkt auf der Fahrbahn,
erfolgt in der Praxis üblicherweise ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen
gegen einen Anprall durch Fahrzeuge. Die "Absperrung" erfolgt
meist durch direkt am Gerüst befestigte Leitbaken, ohne dass ein
zusätzlicher Sicherheitsraum zum fließenden Verkehr vorhanden
ist. Das
Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer (Unachtsamkeit, zu
dichtes Vorbeifahren usw.) führt insbesondere in Kombination
mit konstruktiven Besonderheiten
eines
Gerüstes (in den Lichtraum ragende Gerüstrohre, zu niedrig
ausgeführte Überhänge usw.), nicht selten für spektakuläre
Unfälle, bei denen Gerüste teilweise oder komplett einstürzen - im
schlimmsten Fall zusammen mit den darauf beschäftigten Personen.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Immerhin besser als komplett ohne
Kennzeichnung, aber mit Blick auf den konstruktiven Überhang
(oben im Bild) dennoch unzureichend. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Ähnliche Situation auch hier:
Leitbake und Warnleuchte kennzeichnen nicht die tatsächliche
Außenkante des Gerüstes, denn der Überhang oben im Bild ist
ungesichert. Bemerkenswert ist auch der obligatorische Verweis via Zeichen
1000-12 auf den gegenüberliegenden Gehweg, obwohl ein solcher gar
nicht existiert. |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Leitbaken separat aufstellen
Leitbaken separat aufstellen
Leitbaken sollen ein Gerüst im
Fahrbahnbereich nicht nur
optisch kennzeichnen, sondern indirekt auch eine
Schutzfunktion erfüllen. Zu diesem Zweck müssen sie via
Fußplatte auf der Fahrbahnoberfläche neben dem Gerüst
aufgestellt werden - und sind daher nicht direkt am
Gerüst zu befestigen.
Die Position der Leitbake(n)
bemisst sich zudem nach ggf. vorhandenen konstruktiven Überhängen, die in
den Lichtraum der Fahrbahn ragen. Im Idealfall entsteht
durch die Leitbaken ein mind. 50cm breiter
Sicherheitsraum zwischen dem Gerüst und dem fließenden
Verkehr. |
|
|
| |
|
|
| |
|
 bauliche Schutzmaßnahmen - Schrammborde und temporäre
Schutzeinrichtungen
bauliche Schutzmaßnahmen - Schrammborde und temporäre
Schutzeinrichtungen
Die erforderliche Bewertung wird
insbesondere auf vielbefahrenen Straßen dazu führen,
dass neben der rein verkehrsrechtlichen Absicherung durch
Leitbaken usw. auch bauliche Maßnahmen getroffen werden,
welche Fahrzeuge auf Abwegen aufhalten bzw. umlenken. Hier
sind insbesondere Schrammborde oder temporäre
Schutzeinrichtungen zu nennen. Für die Wirksamkeit
dieser Systeme sind allerdings zahlreiche technische
Parameter zu beachten, so dass sich insbesondere der
Einsatz von temporären Schutzeinrichtungen schwierig
gestalten kann (System- bzw. Prüflänge, Wirkungsbereich
usw.). Auch im Fall von Schrammborden muss die
seitliche Verschiebung im Falle einer Kollision und daher der
notwendige Freiraum zum Gerüst beachtet werden. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Gerüststellung - Absicherung der Montagearbeiten
Gerüststellung - Absicherung der Montagearbeiten
Wie bereits in der Einführung beschrieben, muss
sowohl dem Antragsteller, als auch der genehmigenden Behörde
klar sein, dass sich ein Gerüst nicht "von selbst" auf- und
abbaut. Entsprechend ist der Platzbedarf für LKW bzw.
Kleintransporter, sowie für Kranbetrieb, Schrägaufzüge usw. zu
berücksichtigen. Auch darf es bei genauer Betrachtung nicht
dazu kommen, dass Gerüstbauteile im Luftraum über Verkehrsflächen
(insbesondere Geh- und Radwege) bewegt werden, ohne das ein
räumlicher oder technischer Schutz vor herabfallenden
Gegenständen besteht.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Typische Situation in der Praxis:
Gehweg (Radfahrer frei) vollständig blockiert, Signalgeber der LSA (rechts)
verdeckt. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Augen auf im Straßenverkehr! Die
ursprüngliche Absicherung (Leitbaken zur Sperrung des rechten
Fahrstreifens) wurde entfernt, um einen Anhänger mit
Gerüstbau-Material entgegen der Fahrtrichtung abzustellen. Der
dunkle Anhänger fügt sich wunderbar in den Schatten des Gebäudes
ein und ist dadurch vergleichsweise schlecht sichtbar. Anhänger
und Zugdeichsel blockieren zudem die Fußgängerfurt im Bereich
der LSA. |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Gerüstbau = Arbeitsstelle
Gerüstbau = Arbeitsstelle
Den Verantwortlichen muss bewusst sein,
dass es sich bei der Gerüststellung um eine
eigene Arbeitsstelle im Sinne der RSA 21 handelt, die entsprechend
geplant und abgesichert werden muss. Die notwendige
Bewertung kann auch die Vollsperrung einer Straße nebst
Einrichtung einer Umleitung zur Folge haben, oder den
Betrieb einer Lichtsignalanlage erfordern. Insgesamt
können sich also deutlich umfangreichere
Sicherungsmaßnahmen ergeben, als durch das fertige Gerüst an
sich. In der Praxis wird dieser Sachverhalt in der Regel
komplett ausgeblendet, insbesondere durch die
anordnenden Behörden. Im Sinne der einschlägigen
Vorschriften darf es jedoch nicht privaten Dritten
überlassen sein, ob und in welcher Art sie die von ihnen
geschaffenen Gefahrstellen absichern. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Erkennbarkeit der Absperrung
Erkennbarkeit der Absperrung
Abschließend noch ein
Hinweis zur Funktionsfähigkeit der eingesetzten
Absperrgeräte. Es ist natürlich nicht Sinn und Zweck
einer Gerüstabsperrung, dass diese von Gerüstnetzen oder
Planen verdeckt wird. Was eigentlich selbstverständlich
sein sollte, ist in der Praxis durchaus nicht immer so
einfach wie es scheint: |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Immerhin hat es die
Warnleuchte im Bildhintergrund "ins Freie" geschafft,
wobei die Montageart natürlich alles andere als sinnvoll
ist. Leitbaken sind auf Gehwegen wie beschrieben
unzulässig - nicht viel anders dürfte das Foto bei der
Verwendung von Absperrschranken bzw.
Absperrschrankengittern aussehen. Immerhin ist in diesem
Fall ein gewisser Vandalismus- bzw. Diebstahlschutz
gegeben - ob das so beabsichtigt war, ist allerdings
fraglich ;-) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Bilder aus der Praxis
Bilder aus der Praxis
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Leitbaken dürfen gemäß RSA nicht auf
Gehwegen zum Einsatz kommen (weder vertikal, noch
horizontal). Warnband war bereits gemäß RSA 95 im Fahrbahnbereich unzulässig
(das Foto ist schon älter, aber hinsichtlich der Fehler
zeitlos) und ist u.a. auf Grund der üblicherweise falschen Verwendung
(z.B. auch bei Aufgrabungen) nicht mehr
Bestandteil der RSA 21. Rote Warnleuchten sind nur bei
einer Vollsperrung der Fahrbahn einzusetzen und
insbesondere an Leitbaken unzulässig. Das
"Baustellenschild", welches der DDR-StVO von 1964
entspricht, sollte (in der gültigen StVO-Variante)
eigentlich 30 bis 50m vor der Arbeitsstelle stehen -
natürlich separat aufgestellt und nicht an eine Leitbake
gehangen. Auch die Schilder am Gerüst sind reif für das Verkehrsmuseum. Der
geforderte "Gehwegwechsel" wird nicht
nur durch das zur Wäscheleine zusammengerollte Warnband
erschwert, sondern ist vor allem mit Blick auf die Länge
der Arbeitsstelle mehr als fragwürdig (mehr dazu
später). Hier hätte entweder ein Fußgängerschutzgang
bzw. ein Durchgangsgerüst (auf dem Gehweg), oder ein Fußgängernotweg (auf der
Fahrbahn) eingerichtet werden müssen. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Für Personen mit Rollstuhl,
Rollator, Kinderwagen usw. ist der Weg an der Laterne zu
Ende. Durch die Sperrung von einigen Parkflächen zur Einrichtung
eines Notweges kann diese Situation gelöst werden. Hier
zeigt sich, wie wichtig Kontrollen durch die zuständigen
Behörden sind: Eine Laterne kann man im Rahmen der
Antragstellung bzw. Genehmigung (am Schreibtisch)
durchaus mal übersehen - wichtig ist, dass die
tatsächliche Situation in der Praxis nicht dauerhaft so bleibt, wie
sie hier fotografisch festgehalten wurde. Bezüglich der
"Absperrung" erübrigt sich jeder
Kommentar. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Absperrmaterial aus der
Schrottkiste. Die halbierte Absperrschranke ist zu hoch montiert
und trägt als Aufschrift vermutlich das Maß einer ehemaligen
Höhenbegrenzung. Wären Leitbaken auf Gehwegen zulässig und würde
man sich als Fußgänger an der Richtung der Schraffen
orientieren, müsste man direkt durchs Gerüst hindurch. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Abgesehen von der bemerkenswerten
Anbringung der oberen Leitbake (tatsächlich wäre eine
Absperrschranke in 1,00m Höhe erforderlich), handelt es sich hier
um einen Gehweg mit Freigabe für Radfahrer. Die hierfür
erforderliche Mindestbreite (2,50m, im Ausnahmefall 2,00m) ist
nicht gegeben, so dass gesonderte Maßnahmen bezüglich der
Radverkehrsführung zu treffen sind - und hiermit ist
ausdrücklich nicht die Anbringung des Zusatzzeichens "Radfahrer
absteigen" gemeint. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Der Gesamteindruck erscheint
zunächst recht ordentlich, dennoch sind die Absperrschranken zu
hoch montiert (Oberkante max. 1,00m). Wie üblich wurden
Leitbaken angebracht, obwohl diese gemäß RSA auf Gehwegen
unzulässig sind. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Bei diesem Gerüst fehlt eine
deutliche Querabsicherung durch Absperrschranken. Stattdessen
wurden unzulässigerweise Leitbaken eingesetzt, von denen die
vordere zudem das falsche Bakenblatt zeigt (linksweisend). Auf
die Anbringung von Warnleuchten wurde offensichtlich verzichtet
- dafür wird "Flatterband-Kunst" dargeboten. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
An dieser Stelle wurden gleich beide
Leitbaken falschweisend montiert - wobei es natürlich auch in
diesem Beispiel dabei bleibt, dass Leitbaken nur der
Verkehrsführung auf der Fahrbahn dienen und auf Geh- und
Radwegen unzulässig sind. Ob Kabelbinder sich als
Befestigungsmaterial für Absperrgeräte eignen, darf zudem bezweifelt
werden. Anstelle der Leitbaken sind Absperrschranken
bzw. Absperrschrankengitter als Gerüstabsperrung einzusetzen. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Hier beginnen die Probleme beim
Gerüstbau selbst und entsprechend wurde dazu passend auch die
"Absicherung" ausgeführt. Das Foto spricht für sich. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
...erste künstlerische Versuche mit
Flatterband. Erforderlich wären Absperrschranken in 1,00m
Höhe bzw. Absperrschrankengitter. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
In der Gegenrichtung erfolgt die
Flatterband-Gestaltung deutlich kreativer. Natürlich fehlen auch
hier Absperrschranken bzw. Absperrschrankengitter. Die Ausrichtung der Warnleuchte ist
offenbar für die Einfahrt links im Bild gedacht, als Querabsicherung des
Gehweges ist sie folglich nur bedingt geeignet. Mit
Rundstrahler-Warnleuchten vom Typ WL8 ließen sich beide Anforderungen
gleichermaßen erfüllen. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Andere Stadt, gleiches Prinzip.
Korrekt wären Absperrschranken in 1m Höhe bzw.
Absperrschrankengitter und gelbe
Warnleuchten. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Doch es geht auch ohne Flatterband:
"Querabsperrung" des Gehweges durch eine Mobiltoilette. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Durchgangsgerüst im Zuge einer
Kabelüberführung. Bewertet man die Ausrichtung der
Leitbaken für Fußgänger auf dem Gehweg, so scheint die Richtung
der Schraffen korrekt zu sein. Wenn man aber die ebenfalls erforderliche Sicherung
gegenüber der Fahrbahn hinterfragt, würden die am Bordstein
befindlichen Leitbaken das falsche Bakenblatt (linksweisend) zeigen. Zudem ist
der erforderliche Sicherheitsabstand vom Gerüst zur Fahrbahn nicht gegeben.
Hier müssten also noch zwei Leitbaken auf der Fahrbahn
unmittelbar neben der Bordsteinkante aufgestellt werden. Dies
ergibt jedoch insgesamt ein chaotisches Bild aus roten und weißen
Schraffen. Entsprechend ist im Gehwegbereich eine
Portalkennzeichnung mittels Absperrschranken vorzunehmen und der
Einsatz von Leitbaken ist auf die Fahrbahn zu beschränken. Damit
wird letztendlich auch der Maßgabe der RSA 21 entsprochen, Leitbaken nicht
auf Gehwegen einzusetzen. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Bei dieser Gerüststellung wurden die
Leitbaken separat aufgestellt, was vom Grunde her korrekt ist.
Allerdings erfordert eine vollständige Querabsicherung noch eine
Absperrschranke und mindestens eine zusätzliche gelbe
Warnleuchte. Die hintere Leitbake ist zudem falschweisend
aufgestellt. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Beispiel für eine sinnfreie
Anbringung von Leitbaken und Warnleuchten in Längsrichtung. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Ansicht vom gegenüberliegenden
Gehweg. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Hier fügt sich die Absicherung sehr
gut in den Zustand des Gebäudes ein... |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Diese Absperrschranke kennen wir
bereits von einem anderen Foto. Die "Befestigung" mittels
Kabelbinder (rechts) und bloßes Auflegen auf eine Gerüstkupplung
(links) ist offenbar nur bedingt praxistauglich. Natürlich
bestand diese Situation zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits seit
mehreren Tagen, was auf die Kontrollpraxis der Verantwortlichen
(auch auf Behördenseite) schließen lässt. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Die Beschaffenheit der Lei(d)bake rundet
das Gesamtbild an dieser Seite des Gerüstes ab. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Angesichts des Zustandes der
Absperrschranke ist es
natürlich müßig, über Reflexfolien-Bauarten bzw.
Rückstrahlklassen zu philosophieren. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Durchgangsgerüst ohne ausreichenden
Sicherheitsabstand zur Fahrbahn. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Der Mindestabstand zur Fahrbahn
sollte eigentlich 50cm betragen. Ersatzweise sind daher
Leitbaken unmittelbar an der Bordsteinkante aufzustellen, welche
diesen Sicherheitsraum "künstlich" erzeugen, bzw. Fahrzeuge
räumlich vom Gerüst trennen. Je nach verbleibender
Fahrstreifenbreite kann natürlich ein Ummarkieren mittels
gelber Markierungsfolie erforderlich sein. Im Bereich des
Gehweges fehlt die erforderliche Portalkennzeichnung. Die
Holzbohlen unter den Fußspindeln sorgen auf Grund ihrer
unterschiedlichen Breite
und der mangelhaften Ausrichtung für Stolperstellen. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Durchgangsgerüst mit
unzulässiger Kennzeichnung durch Leitbaken im
Gehwegbereich und zusätzlicher Stolperfalle durch
Treppenstufe. Die lichte Durchgangshöhe
beträgt weniger als 2,20m. Korrekt wären beidseitig angebrachte
Portalrahmen aus Absperrschranken wie vorstehend
beschrieben, sowie Leitbaken auf der Fahrbahn als
räumliche Trennung zur Fahrbahn (hinterer Gerüstbereich
unmittelbar am Bordstein). |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Nahezu vorbildliche Kennzeichnung
eines Durchgangsgerüstes - zumindest was den Fußgängerverkehr
betrifft. Portalkennzeichnung auf beiden Seiten sowie
Längsabsicherung sind vorhanden - allerdings fehlen
Warnleuchten. Wie beschrieben sind die Absperrschranken
zur Längsabsicherung - konstruktiv bedingt - zu hoch angebracht, da die
Durchgangsrahmen zusätzlich zum Geländeausgleich ausgespindelt
werden müssen, um die 2,20m Durchgangshöhe zu erreichen. Im
Bodenbereich sind beidseitige Tastleisten für Sehbehinderte und
Blinde erforderlich (Unterkante max. 15cm). |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Leider steht das Gerüst aber auch in
diesem Fall zu dicht an der Fahrbahn, so dass zumindest
Leitbaken erforderlich wären, um den notwendigen
Sicherheitsabstand (mind. 50cm) zu erzielen. Natürlich können in solchen
Fällen auch
Leitschwellen, Leitborde, Schrammborde usw. zum Einsatz kommen -
je nachdem, wie wirksam der Fahrbahnverkehr vom Gerüst
ferngehalten werden soll. So wie hier darf eine Gerüststellung
jedenfalls nicht erfolgen. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Ein paar Tage später wurde mit der
Fertigstellung des Gerüstes noch eine "Lei(d)bake" sowie eine
Warnleuchte ergänzt. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Der notwendige Sicherheitsraum zur
Fahrbahn wird hierdurch allerdings nicht geschaffen -
stattdessen ist nun die Durchgangsbreite eingeschränkt, wenn
auch nur geringfügig. Abgesehen vom mangelhaften Zustand der
Leitbake (sowohl verbeulter Bildträger, als auch zerschrammte
Oberfläche), stimmt deren Retroreflexionsklasse (RA1) nicht mit
der des Portalrahmens (RA2) überein. Der Portalrahmen
reflektiert daher deutlich stärker, als die nachträglich
montierte Leitbake. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Schulwegsicherheit und
"Gehwegwechsel" in Theorie und
Praxis. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Gegenrichtung. Keine
Absperrschranken, keine Warnleuchten - dafür der Hinweis auf
einen geradezu absurden Gehwegwechsel unmittelbar im
Kreuzungsbereich. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|