|
Einschlagfüße und
Einschlagpfosten
Neben der Aufstellung mittels Fußplatten bzw. Fußplattenträgern
existieren weitere Montagearten, die im Sinne der Technischen
Lieferbedingungen ebenfalls zulässig sind. So sind z.B.
Einschlagfüße insbesondere in der Verkehrssicherungsbranche weit
verbreitet und werden vor allem auf Grund des vergleichsweise
guten Handlings bei deutlich geringem Transportgewicht so oft es
geht eingesetzt. Auch für diese Einrichtungen gelten konkrete
Vorgaben zu Ausführung und Montage und die Praxis zeigt auch
hier, dass diese Vorgaben nicht hinreichend umgesetzt werden. |
|
| |
|
 Feuerverzinkung statt Rost
Feuerverzinkung statt Rost
Schaut man sich Einschlagfüße in der Praxis an, so sind
diese recht oft aus unbehandeltem Stahl hergestellt
und entsprechend verrostet. Was viele
Anwender für ausreichend halten,
ist im Sinne der Technischen Lieferbedingungen
für Aufstellvorrichtungen unzulässig. Hier ist
eine ausreichende Korrosionsbeständigkeit
festgeschrieben, womit für Stahlbauteile eine
Feuerverzinkung gefordert wird (ausgenommen
Edelstahl). Der Einsatz
rostiger Einschlagfüße entspricht somit nicht den Anforderungen der ZTV-SA 97 i.V.m. den
Technischen Lieferbedingungen für
Aufstellvorrichtungen. |
|
|
|
|
|
 Einschlagfüße und Einschlagpfosten
Einschlagfüße und Einschlagpfosten
Insbesondere im Bereich von Böschungen sind
Fußplatten und Fußplattenträger oft
unzweckmäßig, da eine lotrechte Aufstellung nicht möglich
ist, ohne aufwändige (teils sehr fragwürdige)
Unterbauten durchzuführen.
In vielen Fällen
sorgen derartige Lösungen für eine verminderte
Standsicherheit - die eingesetzten Brettchen und Keile
rutschen
weg und das Schild kippt seitlich um
(Foto).
Es ist jedoch auch
die Aufstellung auf losem bzw. rutschigem
Untergrund (Kies, Schotter, Wiese), welche die
Standsicherheit negativ beeinflusst. In diesem
Fall kommt neben dem Kippmoment auch noch die
Gefahr des Gleitens hinzu - insgesamt also recht
ungünstige Vorraussetzungen für eine
standsichere Aufstellung. |
|
|
 |
|
Abgerutschte
Lenkungstafel - was lotrecht ist, zeigt der Leitpfosten. |
|
|
| |
|
Entsprechend sind im
Bereich von Böschungen vorzugsweise
Einschlagfüße bzw. Einschlagpfosten einzusetzen,
sofern hiermit die jeweiligen Windlasten
aufgenommen werden können.
Einschlagfüße (Begriff aus den TL) sind die klassischen "Erdanker"
bzw. "Einschlagspieße", welche über eine
entsprechende Aufnahme für Schaftrohre verfügen.
Bei Einschlagpfosten handelt es sich um
einschlagbare Schaftrohre, ausgestattet mit
Spitze und Schlagfläche am unteren Ende. Sie
sind nur in einteiliger Ausführung zulässig.
 Einschlagtiefe
Einschlagtiefe
Für eine sichere Aufstellung ist
die Einschlagtiefe von Bedeutung, insbesondere
im Hinblick auf die Bodenbeschaffenheit. Die
maximal zulässige Einschlagtiefe beträgt 50cm -
dies wiederum repräsentiert in der Regel auch
die erforderliche Mindesttiefe - denn sonst ist das System
nicht ausreichend in den Boden eingebunden.
Außer Frage steht freilich, dass man auf diese
Wiese prima Kabel und Leitungen aufspüren kann -
diese allgegenwärtige Gefahr ist jedoch kein
Grund, auf ein möglichst tiefes Einschlagen zu
verzichten. Einschlagfüße dürfen zudem maximal
15cm aus dem Boden ragen - eine Festlegung, die
jedoch kaum Beachtung findet. |
|
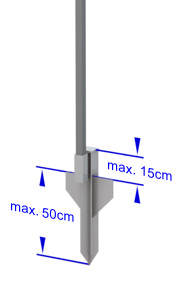 |
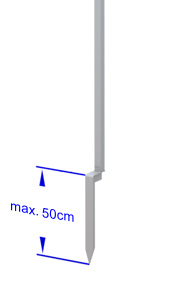 |
|
Einschlagfuß |
Einschlagpfosten |
|
|
| |
|
 Ausrichtung der "Flügel" (seitliche Bleche)
Ausrichtung der "Flügel" (seitliche Bleche)
Einschlagfüße verfügen je nach
Ausführung über seitliche Bleche, die
insbesondere bei Windeinwirkung die Anpresskraft
an den Boden verbessern sollen. Folglich sind
die Einschlagfüße stets so auszurichten, dass
die Bleche parallel zum Schild liegen. Werden
sie hingegen falsch ausgerichtet und liegen
somit parallel zur Windrichtung, wird nur die
schmale Seite des Einschlagfußes gegen den Boden
gepresst - folglich wackelt sich das
Verkehrszeichen langfristig locker, steht
mangels Kontrolle über Wochen schief und kippt
beim nächsten Sturm endgültig um.
Dieser Sachverhalt
ist nicht ganz unproblematisch, denn
insbesondere beim Deaktivieren (Wegdrehen) von
Verkehrszeichen wirkt die Windlast nun von einer
anderen Richtung auf den einst korrekt
ausgerichteten Einschlagfuß. Entsprechend ist
der Einsatz von Produkten ratsam, die nicht nur
über zwei, sondern über vier dieser Bleche
verfügen. Dann ist in jedem Fall der
Anpressdruck gegen den Boden gewährleistet, egal
wie das Schild ausgerichtet ist.
Natürlich sind
der Standsicherheit von Einschlagfüßen Grenzen
gesetzt, insbesondere an steilen Böschungen. Je
nach Windrichtung drückt die Aufstellvorrichtung
gegen einen ganzen Wall an Erdreich oder eben
nur gegen wenige Zentimeter. Folglich ist der
Wind an solchen Stellen in der
Lage, ein deaktiviertes Schild aus der Böschung
heraus zu drücken. |
|
|
 |
|
Nachlässige
Aufstellung mit Einschlagfuß. Die Flügel
müssen im Boden verschwinden, sonst sind sie unwirksam. |
|
|
| |
|
 Windstreben
Windstreben
Wie die
bisherigen Erläuterungen zeigen, haben
Einschlagfüße einige Nachteile und hier ist vor
allem der Umstand zu nennen, dass die
Standsicherheit maßgeblich vom Boden abhängig
ist, den man nun mal nicht beeinflussen kann.
Folglich versucht
man in der Praxis diese Defizite mit sog.
Windstreben zu kompensieren. Korrekt angebracht,
können dies Streben die Standsicherheit
verbessern, sie haben jedoch auch Grenzen. Dort
wo man den Einschlagfuß ohne Mühe per Hand
herausziehen kann, hat auch die Windstrebe in
der Regel keine ausreichende Verbindung zum
Boden.
Zudem ist dieses
System in erster Linie auf Druck, aber nicht auf
Zug konzipiert. Und so ist es in der Praxis
keine Seltenheit, dass derartig aufgestellte
Schilder z.B. bei Ostwind stehen bleiben und bei
Westwind samt Windstreben aus dem Boden gezogen
werden - auch hier natürlich abhängig von der
Bodenbeschaffenheit |
|
|
 |
|
Verkehrszeichen mit Windstreben |
|
|
|
 Unfallgefahr
Unfallgefahr
Windstreben können vor allem bei
unsachgemäßer Ausführung bzw. Anbringung zur Unfallgefahr
werden.
Im Grunde handelt es sich dann gewissermaßen um Speere oder Lanzen,
die am Boden verankert und in Richtung des
Fahrzeugführers ausgerichtet sind. Es ist daher
wichtig, die gesamte Konstruktion so aufzubauen,
dass sie im Fall einer Kollision keine
zusätzliche Gefahr darstellt. |
|
|
| |