| |
|
|
| |
|
LED-Wechselverkehrszeichen sind vor
allem an Arbeitsstellen im Bereich der Bundesautobahnen seit
vielen Jahren erfolgreich im Einsatz. Mobile
Wechselverkehrszeichen, üblicherweise in Gestalt fahrbarer
LED-Vorwarnanzeiger, repräsentieren das Standardelement zur
Beschilderung von Arbeitsstellen kürzerer Dauer. In der
Verkehrssicherungsbranche werden sie umgangssprachlich als LED-Vorwarner,
LED-Vorwarntafel, LED-Vorwarnanhänger oder - ganz übel - als
LED-Schilderwagen
bezeichnet.
Der amtliche Begriff Vorwarnanzeiger entstammt der
verkehrsjuristisch etwas überzogenen Auffassung, dass eine
Trägertafel gemäß § 39 Abs. 4 StVO weiß ist, was auf klassische
Vorwarntafeln nach RSA nicht zutrifft, weshalb diese in der
Konsequenz auch nicht als Vorwarntafel bezeichnet werden dürfen.
LED-Vorwarntafeln heißen deshalb ganz korrekt "Vorwarnanzeiger mit
lichttechnischem Informationsteil" - der Autor belässt es in
diesem Beitrag aber bei "LED-Vorwarnanzeiger".
Als teilstationäre Anlagen
dienen LED-Wechselverkehrszeichen u.a. der Stauwarnung an
Arbeitsstellen, sie
geben Informationen über Sperrungen und den dazugehörigen Umleitungsstrecken, oder werden zur Realisierung
tageszeitabhängiger Geschwindigkeitsbeschränkungen als Folge der
ASR A5.2 genutzt. Zunehmend kommen sie anstelle konventioneller
Fahrstreifen- und Verkehrslenkungstafeln zum Einsatz, um
beispielsweise Wechselverkehrsführungen zu realisieren. Eine
weitere Anwendung sind Anlagen zum Detektieren und Ausleiten
schwerer Fahrzeuge im Bereich maroder Brücken.
In den RSA 21 werden Vorwarnanzeiger
in den jeweiligen Regelplänen als LED-Wechselverkehrszeichen
abgebildet (invertierte Darstellung von Schwarz und Weiß) -
also gemäß dem Stand der Technik. Hierbei wurde allerdings eine
Gestaltung gewählt, die sich mit den bisher am Markt verfügbaren
Systemen nicht hinreichend umsetzen lies, nämlich eine
Längenangabe unter Zeichen 274 sowie das Zusatzzeichen
"Seitenstreifen befahren".
|

LED-Vorwarnanzeiger aus dem Jahr 2009 |
|
|
| |
|
|
| |
|
Der Autor hat das damals
thematisiert,
worauf in einem Artikel (Straße und Autobahn
04.2022) indirekt Bezug genommen wurde. So wurde erklärt, dass
man mit der neuen Darstellung in den RSA 21 auch einen
Entwicklungsimpuls verbinden würde, welcher die Hersteller zur
Konstruktion entsprechender Anlagen anregen solle. In der
Tat besteht in der Verkehrssicherungsbranche - verglichen mit
anderen Technologien - eine vergleichsweise überschaubare
Innovationskraft mit einer ausgeprägten Huhn-Ei-Problematik:
Neue oder verbesserte Produkte werden aus eigenem Antrieb nur selten entwickelt,
da sie nicht nachgefragt werden und sie werden nicht
nachgefragt, weil es sie nicht gibt. Nachdem ein Dienstleistungsunternehmen für Verkehrssicherung einen eigenen
LED-Vorwarnanzeiger mit einer großen einteiligen Anzeigefläche
vorgestellt hatte, kam etwas Bewegung in den Markt. Inzwischen
bieten auch die bekannten Hersteller ihre LED-Vorwarnanzeiger mit
einteiliger Anzeigefläche an, wodurch sich die Möglichkeiten zur
Darstellung der Inhalte gemäß RSA 21 deutlich verbessern.
Allerdings lässt sich mit
LED-Matrix-Verkehrszeichen auch jede Menge Unfug veranstalten
und genau hier soll dieser Beitrag ansetzen. So entsprechen
viele Darstellungen bereits herstellerseitig nicht den Mustern
der amtlichen Verkehrszeichen nach StVO, Grundzüge der
Schriftgestaltung werden nicht beachtet und verkehrsrechtlich
fragwürdige Schaltungen sind an der Tagesordnung. Damit ist
natürlich nicht gemeint, dass sich Verkehrszeichen auf einer
LED-Matrix nur mit gewissen grafischen Abstrichen darstellen
lassen, sondern es geht um die Klarstellung, ab wann man sowohl den grafischen
als auch den verkehrsrechtlichen Rahmen verlässt. Ziel dieses
Beitrages ist die Sensibilisierung der Verantwortlichen sowohl
auf Seiten der Auftraggeber und Behörden, der mit der Ausführung befassten Dienstleistungsunternehmen für Verkehrssicherung, aber auch der Hersteller von
LED-Vorwarnanzeigern und teilstationären LED-Wechselverkehrszeichen.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Gegenüberstellung des Gefahrzeichens
123
"Arbeitsstelle" gemäß StVO (links) und gestalterisch fragwürdige
Umsetzung via LED-Matrix (rechts). |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Verständliche aber von StVO und
VzKat abweichende Darstellung einer Fahrstreifenreduktion
(unzulässiges Quadrat und "verschmolzene" Fahrstreifen). |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Low-Budget-Wechselverkehrszeichen
Low-Budget-Wechselverkehrszeichen
Bevor wir in das Thema LED-Wechselverkehrszeichen einsteigen
soll eine fehlgeleitete Rechtsauffassung besprochen
werden, die in vielen Planungsbüros,
Dienstleistungsunternehmen, Verkehrs- und Straßenbaubehörden
sowie bei der Polizei weiterhin an der Tagesordnung ist: Die
vermeintliche Zulässigkeit von zeitlich
verschachtelten Geschwindigkeitsbeschränkungen:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Zwei unterschiedliche Zeichen 274 gelten zur selben Zeit.
Beschilderungen wie diese sind verkehrsrechtlich gesehen grober
Unfug. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
|
Die Vorgaben der ASR A5.2 erfordern
häufig eine arbeitstägliche Reduzierung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit an Strecken, die bereits auf Grund der
arbeitsstellenbedingten Verkehrsführung mit einer
Geschwindigkeitsbeschränkung versehen sind. Die vermeintliche
Logik hinter der gezeigten Beschilderung besteht darin,
dass das Zeichen 274-60 (60km/h) das allgemeine Tempolimit
repräsentiert, welches von Montag bis Freitag jeweils in der
Arbeitszeit von 7 bis 19 Uhr aus Gründen des Arbeitsschutzes auf
40km/h reduziert wird. Das ist vom Grunde her verständlich und sogar nachvollziehbar - nur werden eben im relevanten Zeitraum
zwei unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten auf derselben
Strecke angeordnet,
nämlich 60 km/h und 40 km/h. Um das Problem zu verstehen muss man sich das
Zusatzzeichen in der relevanten Zeit einfach wegdenken - so als
würde das Baustellenpersonal morgens um 7 Uhr das Zeichen 274-40 anbringen und um 19 Uhr wieder demontieren. Das Zeichen
274-60 ist jedoch die ganze Zeit präsent.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die VwV-StVO führt diesbezüglich
unmissverständlich aus, dass Verkehrszeichen, die nur zu bestimmten
Zeiten gelten sollen, sonst nicht sichtbar sein dürfen - wobei
bestimmte Schilder (u.a. Zeichen 274) per Zusatzzeichen zeitlich
beschränkt werden dürfen. Man müsste daher im Falle der
gezeigten Low-Budget-Lösung auch das Zeichen 274-60 für den
übrigen Zeitraum durch ein weiteres Zusatzzeichen beschränken,
wobei auch Samstag und Sonntag zu berücksichtigen
sind. Das Ergebnis in Gestalt zweier Vorschriftzeichen mit
jeweils einem eigenen Zusatzzeichen stellt am Ende aber keine
wirkliche Verbesserung dar, sondern nur eine formell
rechtssichere Ausführung.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Beschilderungen wie die gezeigte
sind keine
Lösung und eröffnen ambitionierten Verkehrsjuristen ein
dankbares
Betätigungsfeld.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Eine derartige Regelung kann nur durch den Einsatz
von Wechselverkehrszeichen umgesetzt werden, mit welchen
man zudem flexibel auf die Erfordernisse der Arbeitsstelle
reagieren kann. Wenn die aktuellen Arbeiten beispielsweise keinen
Aufenthalt im Grenzbereich zum Straßenverkehr erfordern (siehe
Foto - Arbeiten am Mittelstreifen), dann besteht auch kein Grund
für eine zusätzliche Geschwindigkeitsbeschränkung und
folgerichtig gilt dann auch während der Arbeitszeit Tempo 60.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Durch den Einsatz von Wechselverkehrszeichen kann die zusätzliche
Geschwindigkeitsbeschränkung zudem auf einen räumlich begrenzten
Bereich beschränkt werden, so dass eben nicht auf 5 km Länge
pauschal ein Tempolimit von 40km/h gilt, weil irgendwo an einem kurzen Teilstück gerade im
Grenzbereich zum Straßenverkehr gearbeitet wird. Die
Realisierung einer solchen Beschilderung durch
LED-Wechselverkehrszeichen repräsentiert dabei nicht nur den
Stand der Technik sowie eine rechtssichere Ausführung, sondern
sie dient auch der Akzeptanz von
Geschwindigkeitsbeschränkungen. Der Verkehrsteilnehmer
erkennt nämlich durchaus, ob eine Regelung situativ eingesetzt wird
und nicht per Gieskanne.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Keine Hierarchie zwischen LED-Verkehrszeichen und Blechschildern
Keine Hierarchie zwischen LED-Verkehrszeichen und Blechschildern
Eine weitere fragwürdige Auffassung besteht
in der Annahme, dass lichttechnisch erzeugte Verkehrszeichen vorhandenen
Blechschildern vorgehen würden. Vor allem in
einigen Betriebsleitstellen der Autobahnen ist diese Meinung
seit vielen Jahren etabliert und so konkurrieren an bestimmten
Strecken klassische Blechschilder mit
LED-Verkehrszeichen um die Wette. Das Ergebnis sieht dann etwa
so aus:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
|
Die LED-Verkehrszeichen der VBA
sollen den Blechschildern am Fahrbahnrand auf der gesamten
Strecke vorgehen - dafür fehlt jedoch die Rechtsgrundlage.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Woher diese irrige Annahme stammt
ist unklar, anhand der StVO lässt sie sich jedenfalls nicht belegen.
Möglicherweise wird die Regelung zu Lichtzeichenanlagen (§ 37
StVO) mit den lichttechnisch erzeugten Schildern (also
vermeintlich
"Lichtzeichen") gleichgesetzt,
was so natürlich nicht richtig ist. Die Wechsellichtzeichen des
§ 37 Abs. 2 StVO sind "Ampeln", die Dauerlichtzeichen des
§ 37 Abs. 3 StVO sind rote gekreuzte Schrägbalken, grüne nach unten
gerichtete Pfeile oder schräg nach unten gerichtete gelb
blinkende Pfeile. Letztere können zwar durch
Verkehrsbeeinflussungsanlagen angezeigt werden, allerdings sind
die klassischen Wechselverkehrszeichen (Zeichen 101, 274, 276
und 277 gemäß RWVZ)
keine Lichtzeichen im Sinne des § 37 StVO. Zudem gehen echte Lichtzeichen (also Ampeln) nur Vorrangregeln und Vorrang
regelnden Verkehrszeichen vor.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Verkehrsrechtlich unproblematisch
aber dennoch fehlerhaft: Stationäre Ankündigung derselben
Arbeitsstelle in 800m (Blech) und in 1000m (VBA). |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Dauerlichtzeichen (hier rot gekreuzte
Schrägbalken) werden zwar von derselben Anzeigefläche erzeugt
und sind als Anforderung in den RWVZ vorgesehen,
dennoch sind die daneben befindlichen Verkehrszeichen 274-80 und
123 keine "Lichtzeichen" i.S.d. § 37 StVO, auch wenn sie
ebenfalls lichttechnisch erzeugt werden. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
In diesem Zusammenhang ist auch
eine andere Frage interessant: Wie werden rot gekreuzte
Schrägbalken und das damit angeordnete Befahrverbot des
Fahrstreifens in so einem Fall eigentlich wieder aufgehoben? Dafür müsste man am
Ende der Arbeitsstelle den nach unten gerichteten grünen Pfeil
zeigen, aber den können viele Verkehrsbeeinflussungsanlagen gar
nicht darstellen, auch weil die Richtlinien für
Wechselverkehrszeichen (RWVZ) dies bislang nicht vorsehen. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Am Abschluss einer durch
Dauerlichtzeichen geregelten Strecke ist über allen Fahrstreifen
der grüne nach unten gerichtete Freigabepfeil anzuzeigen, um ein
zuvor durch rote gekreuzte Schrägbalken angeordnetes
Befahrverbot rechtswirksam und vor allem eindeutig wieder
aufzuheben. |
|
|
| |
|
|
| |
|
Lichttechnisch erzeugte
Verkehrszeichen stehen in der Hierarchie mit Blechschildern auf
einer Ebene, so das bei gleichzeitig gültigen LED-Schildern und
Blechverkehrszeichen ggf. ein Widerspruch entsteht. Die einzigen Verkehrszeichen, die
den Anordnungen von ortsfest angebrachten
Schildern vorgehen, sind solche die an Fahrzeugen montiert sind
(§ 39 Abs. 6 StVO).
Das sind gemäß dem Stand der Technik üblicherweise fahrbare
LED-Vorwarnanzeiger und wenn diese beispielsweise ein Zeichen 274-80
anzeigen, geht diese Anordnung einem ortsfesten Zeichen 274 vor: |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Vorwarnanzeiger sind Fahrzeuge und
gehen damit gemäß § 39 Abs. 6 StVO den vorhandenen
Verkehrszeichen vor. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Das gilt auch für konventionelle Vorwarnanzeiger,
in diesem Fall mit
Prismenwender. Der Einsatz dieser "Oldtimer" ist allerdings eher
fragwürdig. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Bei dieser Umsetzung eines
"Vorwarnanzeigers" handelt es sich nicht um ein Fahrzeug, so
dass evtl. vorhandene Zeichen 274 deaktiviert werden müssen. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Im Übrigen stellt eine derartige
Beschilderung allenfalls eine Notlösung dar, welche nur auf
Streckenabschnitten ohne (ausreichend breiten) Seitenstreifen einzusetzen
ist. Bei der Verwendung solcher Tafeln müssen die Verkehrszeichen in Größe
und Gestaltung natürlich dem VzKat entsprechen, was im konkreten
Beispiel eher
weniger gelungen ist. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Stand der Technik - Anzeigengröße und
Auflösung
Stand der Technik - Anzeigengröße und
Auflösung
Wenn Hersteller und
Dienstleistungsunternehmen im Zusammenhang mit
LED-Wechselverkehrszeichen von "modernster Technik"
oder "smarten Anlagen" sprechen, ist damit oft der technische Stand aus den
1980er und 1990er Jahren gemeint. Zwar sind heutzutage u.a. die
Steuerungsmöglichkeiten der Anlagen deutlich komfortabler und
anstelle von Systemen in Lichtfasertechnik oder monochromer LED-Displays
werden zunehmend RGB-Anzeigen eingesetzt - die verfügbare
Auflösung setzt den werbewirksamen Aussagen aber oftmals Grenzen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
Fahrbare dynamische Vorwarntafel
(Lichtfasertechnik) der Firma Dambach aus dem Jahr 1995. Viel hat sich
in Sachen Auflösung seit dem nicht verändert. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Detailansicht der LED-Matrix eines
teilstationären Wechselverkehrszeichens. Ein Pixelabstand
von 20 mm repräsentiert weiterhin den Stand der Technik.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Detailansicht eines stationären
LED-Wechselverkehrszeichens mit 16mm Pixelabstand.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Während LED-Videowände in der
Veranstaltungstechnik üblicherweise ein Pixelpitch (Raster)
zwischen 2 und 8 mm aufweisen (je nach System und Anwendung
auch deutlich geringer oder etwas größer), repräsentiert ein
Raster von 20 - 25 mm
in der Verkehrstechnik weiterhin den Branchenstandard. Zur
Abbildung der üblichen Verkehrszeichen in den regulären Größen
nach RWVZ genügt das im Regelfall, aber sowohl die Dienstleistungsunternehmen
für Verkehrssicherung als auch deren Auftraggeber planen oftmals
Inhalte, die sich
mit der verfügbaren Technik nicht oder nur unzureichend umsetzen lassen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 |
 |
|
LED-Matrix aus der Veranstaltungstechnik mit einem Pixelabstand
von 2,6 mm |
LED-Matrix aus der Verkehrstechnik mit einem Pixelabstand von 20
mm |
|
|
| |
|
|
| |
|
Zwar sind die Anforderungen des
Straßenverkehrs nur bedingt mit denen der Veranstaltungstechnik
vergleichbar (Stichwort: DIN EN 12966), in der Gesamtbetrachtung bleibt die
Verkehrstechnik im Anwendungsbereich der RSA 21 aber deutlich hinter den technischen
Möglichkeiten zurück. In der Praxis wird natürlich trotzdem
versucht, auf einer Anzeigefläche mit lediglich 48 x 60 oder 64
x 80 Pixel verkleinerte Verkehrszeichen und Sinnbilder,
Autobahn- und Bundesstraßennummern oder umfangreiche Texte abzubilden - oft
mit fragwürdigem Ergebnis. Dabei gibt es auch in der
Verkehrstechnik inzwischen andere Lösungen, u.a. bei
Stadtinformations- und Parkleitsystemen:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
LED-Wegweiser eines Parkleitsystems
mit einer für die Verkehrstechnik vergleichsweise hohen Auflösung.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Empfehlungen für künftige Entwicklungen
Empfehlungen für künftige Entwicklungen
Eine hochauflösende Darstellung von
LED-Wechselverkehrszeichen mit z.B. 1,9mm Pixelabstand ist
natürlich unnötig, auch wenn dies technisch durchaus realisierbar
ist. Die verschiedenen Anwendungen in der Praxis erfordern aber
zumindest ein Raster von maximal 10 - 12mm (besser 5 - 8mm), um verkehrsrechtlich
relevante Details hinreichend darstellen zu können. Das
beispielsweise bei der Wiedergabe von Zeichen 264 auf
Fahrstreifen-Pfeilen einfach die Einheit "m" weggelassen oder an
anderer Stelle im Schild positioniert wird, weil sie auf Grund
der groben Auflösung branchenüblicher LED-Tafeln nicht
darstellbar ist, kann jedenfalls nicht die Lösung sein (mehr
dazu später).
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
unzulässige Varianten von Zeichen 264 aus der Praxis |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Modularer Aufbau bei teilstationären Anlagen
Ein weiteres Manko besteht in der festgelegten
Größe der Anzeigefläche von teilstationären Anlagen, welche in
Anlehnung an konventionelle Fahrstreifen- und
Verkehrslenkungstafeln üblicherweise etwa 1280 x 1600 mm oder
1280 x 1920 mm beträgt
(entsprechend dem Maß des LED-Rasters
zzgl. Gehäuse). Diese Größe ist für die meisten Anwendungen
zunächst ausreichend, zumal der verfügbare Platz insbesondere im
Mittelstreifen oft begrenzt ist. Allerdings gibt es auch
Projekte, bei denen z.B. Wegweiser in LED nachgebildet werden
sollen und entsprechend erfolgt die Montage mehrerer LED-Tafeln über- oder
nebeneinander. Hierdurch entsteht zwangsläufig
eine konstruktive Unterbrechung der Anzeigefläche, die sich - je nach
erforderlicher Abbildung - in das Gesamtbild integrieren lässt,
oder eben stört.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
LED-Videowände in der
Veranstaltungstechnik werden dagegen aus randlosen Modulen
zusammengesetzt, wodurch eine homogene Anzeigefläche entsteht.
Die einzelnen Elemente sind sowohl elektrisch als auch
mechanisch so ausgeführt, das sie vor Ort werkzeuglos
zusammengesetzt und wieder demontiert werden können. Hierzu
werden die Module mit Leitungen für Spannungsversorgung und
Daten miteinander verbunden und über einen zentralen Controller
angesteuert. Ein derartiges Konzept wäre - natürlich mit
entsprechenden Anpassungen - auch in der Verkehrstechnik
sinnvoll, um teilstationäre LED-Wechselverkehrszeichen in der
Größe skalieren zu können. In Kombination mit der schon
erwähnten Verbesserung der Auflösung würde es sich um ein System
handeln, dass heutigen und künftigen Ansprüchen wirklich gerecht
wird und folglich auch die Bezeichnung "modern" verdient.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Technische Defizite - Degradation
Technische Defizite - Degradation
Bei allen Vorzügen der
LED-Technik gibt es natürlich auch einige Defizite. Je nach
System, Hersteller und Einsatzdauer altern die LEDs schneller oder langsamer -
aber sie altern. Dieser als Degradation bezeichnete Prozess ist
auch bei LED-Wechselverkehrszeichen gegeben und wird vor allem
dann sichtbar, wenn ein sonst dauerhaft angezeigtes
Verkehrszeichen - im Sinne seiner eigentlichen Bestimmung -
einen anderen Inhalt wiedergeben muss:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Diese Wechselverkehrszeichen zeigen
ständig das Zeichen 274-80 an und nur in besonderen Fällen
eine andere Geschwindigkeitsbeschränkung. Da die LEDs der 4 quasi
neuwertig sind, leuchten sie heller als die 0, welche bei
allen darstellbaren Varianten (80, 60, 40) dieselbe ist und
dauerhaft leuchtet.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Im Anwendungsbereich der RSA 21 ist
der beschriebene Effekt vor allem bei
teilstationären LED-Wechselverkehrszeichen zu beobachten, wobei
hier auch immer die eingesetzte LED-Technologie eine Rolle
spielt. Wenn beispielsweise an einer Langzeit-Baustelle
dauerhaft ein bestimmter Inhalt angezeigt wird, sind die hierfür
genutzten LEDs einer Alterung durch den aktiven Betrieb
ausgesetzt, während die restlichen LEDs der Anzeigefläche
inaktiv sind und folglich geschont werden. Wird auf einer
solchen Tafel dann ein anderer Inhalt angezeigt, erscheinen die
bislang nicht verwendeten LEDs deutlich heller und weisen
insgesamt eine
einheitliche Lichtstärke auf, während die bereits "gebrauchten"
LEDs mit unterschiedlicher Intensität leuchten. Je älter die
Anlage ist und je öfter sie über einen längeren Zeitraum
denselben Inhalt angezeigt hat, umso deutlicher werden die
Unterschiede:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
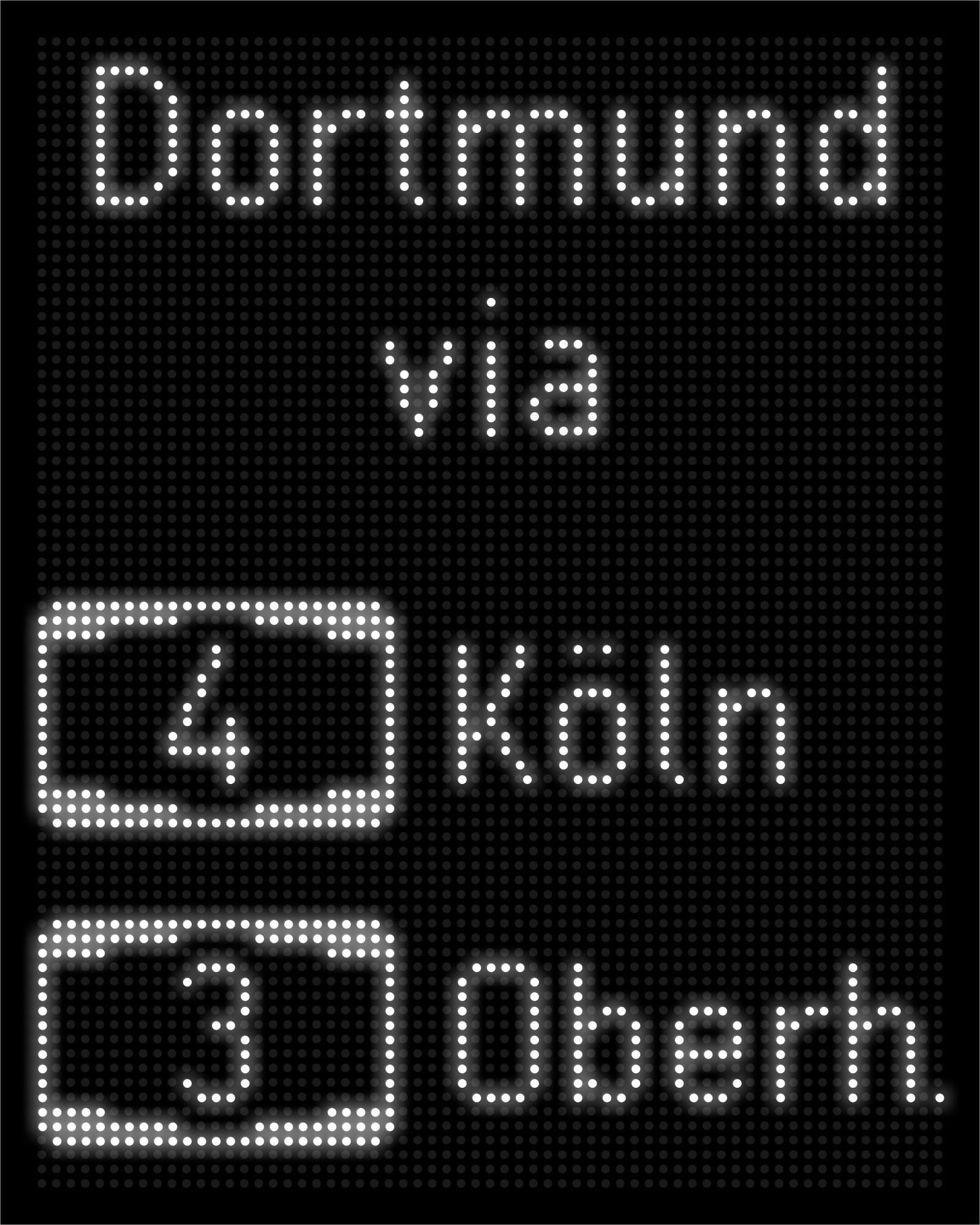 |
|
|
|
LED-Wechselverkehrszeichen mit
unterschiedlich gealterten LEDs |
Darstellung im Neuzustand |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 verkehrsrechtliche
Grundlagen zu LED-Wechselverkehrszeichen
verkehrsrechtliche
Grundlagen zu LED-Wechselverkehrszeichen
Die StVO beschreibt im § 39 Abs. 4, dass in
Wechselverkehrszeichen die weißen Flächen schwarz und die
schwarzen Sinnbilder und der schwarze Rand weiß sein können,
wenn diese Zeichen nur durch Leuchten erzeugt werden:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|
|
Zeichen
274-80
reguläre Darstellung |
Schwarz-Weiß-Umkehr |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die Begrifflichkeit "kann" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass
die sog. Schwarz-Weiß-Umkehr bei LED-Wechselverkehrszeichen zulässig
und gegenüber dem Verkehrsteilnehmer verbindlich
ist, sie besagt aber nicht, dass die Darstellung zwingend so erfolgen muss. Ein
typisches Beispiel hierfür ist Zeichen 250, welches mit dem
heutigen Stand der Technik
problemlos in einer 1:1 Farbdarstellung angezeigt werden kann und
deshalb auch so anzuzeigen ist:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
Zeichen
250
reguläre Darstellung |
Schwarz-Weiß-Umkehr |
Farbdarstellung 1:1 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die mittlere Abbildung
repräsentiert die klassische Schwarz-Weiß-Umkehr gemäß StVO,
weshalb das Ergebnis nur aus einem roten Ring besteht. Deutlich
besser ist die rechts abgebildete 1:1 Farbdarstellung,
wobei auf die Abbildung des weißen Kontraststreifens verzichtet
wurde, da sich der Kontrast bereits aus dem schwarzen
Hintergrund ergibt. Doch auch dieses Detail wäre mit den heute
verfügbaren Anlagen problemlos darstellbar. Der schmale schwarze
Ring ist bei einigen Anlagen zur Trennung der Farben Rot und
Weiß erforderlich, damit diese nicht visuell zusammenfließen.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Die Darstellung von Zeichen 250 als
klassische Schwarz-Weiß-Umkehr ist alles andere als sinnvoll.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Beispiel für die 1:1 Farbdarstellung
von Zeichen 250 (rechts) im Vergleich zur klassischen Schwarz-Weiß-Umkehr
bei Zeichen 101 (links). Die unzulässige Verwendung von Zeichen 101
(Gefahrstelle) als bloße "Ankündigung" bzw. "Hinweis" wird
später besprochen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Zeichen 267
Zeichen 267
Auch die Wiedergabe von Zeichen 267 muss als
1:1 Farbdarstellung erfolgen, da die einfache Schwarz-Weiß-Umkehr
ebenfalls ein fragwürdiges Ergebnis darstellt:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
Zeichen
267
reguläre Darstellung |
Schwarz-Weiß-Umkehr |
Farbdarstellung 1:1 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die schmale schwarze Umrandung des
weißen Querbalkens ist wie bei der Darstellung von Zeichen 250
bei einigen Anlagen zur Trennung der Farben Rot und Weiß
erforderlich, damit diese nicht visuell zusammenfließen. Je nach
System kann das Zeichen aber auch ohne dieses grafische
Hilfsmittel 1:1 abgebildet werden.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Bastelkram
In einigen Bibliotheken von
LED-Vorwarnanzeigern findet sich eine fragwürdige Mutation aus
Zeichen 250 und 267, die so selbstverständlich nicht
anordnungsfähig ist und keine Regelung im Sinne von Zeichen 267 gegenüber
dem Verkehrsteilnehmer erwirkt. Im Zuge der unbedarften Auswahl der
jeweiligen Inhalte durch die Anwender kommt diese unzulässige Kreation in der Praxis natürlich
trotzdem zum Einsatz:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
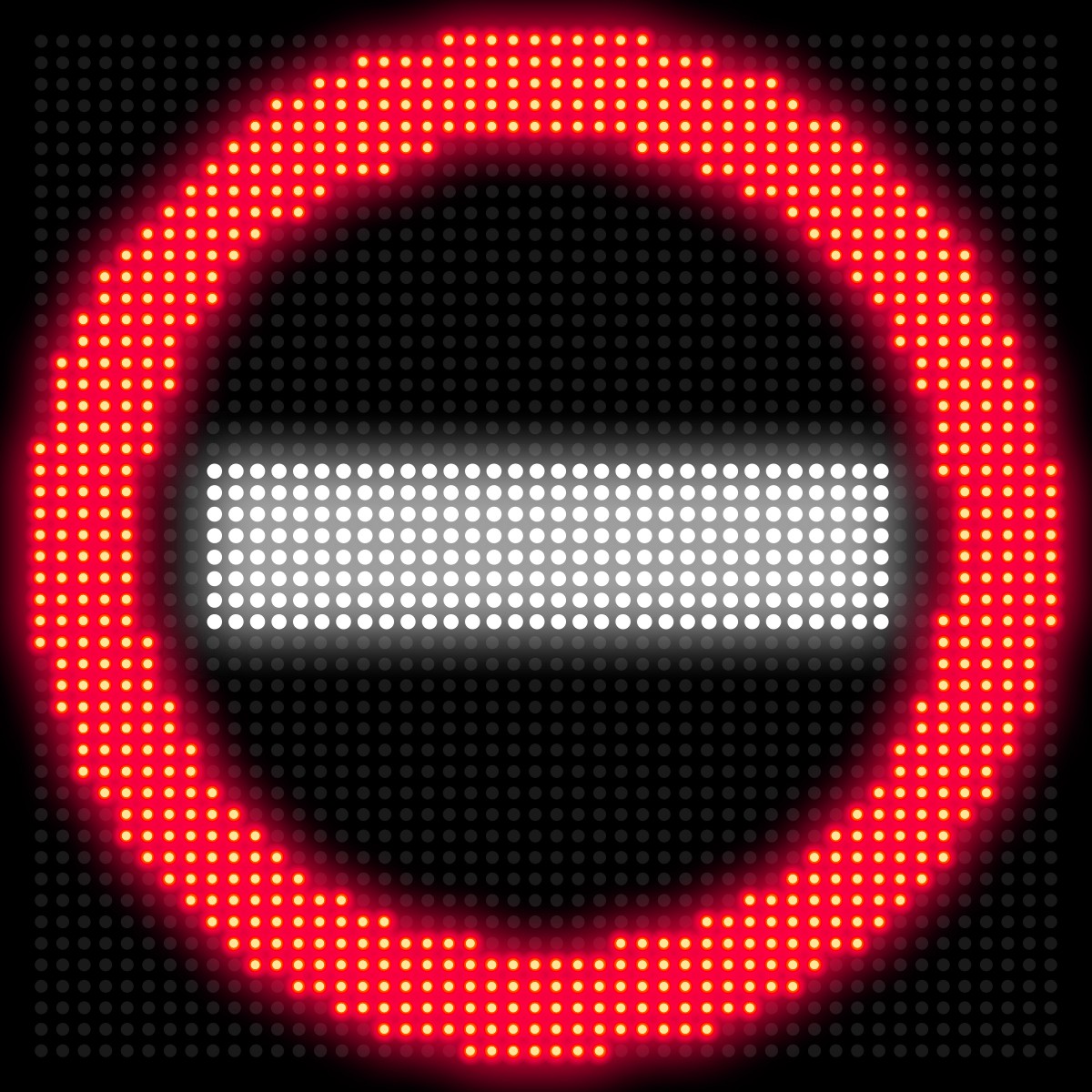 |
 |
|
|
|
fragwürdiger Versuch zur
Darstellung von Z 267 |
adaptierte Darstellung
=
kein Zeichen nach StVO |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Verkehrszeichen mit blauer oder gelber Grundfläche
Verkehrszeichen mit blauer oder gelber Grundfläche
Die Wiedergabe von Verkehrszeichen mit gelber
oder blauer Grundfläche erfolgt ebenfalls als 1:1
Farbdarstellung. Zwar werden
insbesondere gelbe und blaue Umleitungsschilder sowie Autobahn-
und Bundesstraßennummern in der Praxis auch gern in Weiß
dargestellt, dies liegt aber oft nur an den technischen
Unzulänglichkeiten der eingesetzten Systeme (monochrome oder
lediglich weiß/rote LED-Bestückung der Anzeigefläche).
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Umleitungsschilder sind 1:1
darzustellen, in diesem Fall blauer Grund mit weißer Schrift (Zeichen 460). Dasselbe gilt für die Autobahnnummer
Zeichen 405.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Beispiel für die farbige Darstellung
eines Umleitungshinweises sowie Verzicht auf die unzulässige
Abbildung von Zeichen 101 als Hinweis auf eine Sperrung.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Gelb ist nicht Weiß und Weiß ist nicht Rot
Gelb ist nicht Weiß und Weiß ist nicht Rot
Die ersten LED-Vorwarnanzeiger der 1990er Jahre
wurden mangels leistungsfähiger weißer LEDs mit gelben Leuchtdioden
bestückt. Dieser technische Kompromiss hielt auch noch viele
Jahre nach Einführung weißer LEDs an, da die neuen Anlagen mit
einem entsprechenden Aufpreis angeboten wurden, weshalb der sparsame
Kunde weiterhin die preiswerte Variante mit gelber
LED-Bestückung bevorzugte. Daher Korrektur zum oben Gesagten: Es
handelt sich in der Verkehrssicherungsbranche in der Regel um eine
ausgeprägte Huhn-Ei-Preis-Problematik.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Abbildung aus dem Produktkatalog der
Firma Nissen von 1998.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Bezüglich der bloßen Darstellung von
Fahrstreifen- und Verkehrslenkungstafeln ist die farbliche
Abweichung weitgehend unkritisch, da hiermit keine Ge-
oder Verbote verknüpft sind, sondern nur der Verlauf und die
Anzahl von Fahrstreifen angegeben wird (vgl. Anlage 3 lfd. Nr.
80 StVO). Der StVO entspricht
eine derartige Ausführung trotzdem nicht, so dass auch
Fahrstreifenpfeile ausschließlich in Weiß dargestellt werden dürfen
(oder Schwarz bei einer 1:1 Farbdarstellung). Problematisch ist die
Farbwahl bei der Wiedergabe von Vorschriftzeichen wie
Zeichen 274, denn hierfür sind gelbe Ziffern
unzulässig. Dies betrifft auch die Abbildung von Zeichen
276 oder 277 sowie die Wiedergabe von Vorschriftzeichen auf den Pfeilen von Fahrstreifentafeln.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
unzulässige Darstellung
von Z 274-80 und 276 (Gelb statt Weiß) |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Ähnlich verhält es sich mit dem
Versuch, auf monochromen LED-Anzeigeflächen Vorschriftzeichen
darzustellen. Die Hersteller bieten natürlich auch hierfür
vorgefertigte Bibliotheken an und die Anwender nutzen diese
auch. So werden insbesondere auf den monochromen Untertafeln von
LED-Vorwarnanzeigern Vorschriftzeichen mit weißem oder gelbem
Rand dargestellt, was selbstverständlich nicht der StVO
entspricht und folglich keine entsprechenden
Verhaltensvorschriften auslöst. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|
|
unzulässige Darstellung
von Z 264 monochrom in Gelb bzw. Weiß. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Da inzwischen zunehmend RGB-Systeme
im Einsatz sind, erledigt sich das Problem langfristig von
allein. Allerdings nutzen gerade kleinere Unternehmen auch gern
ausgemusterte LED-Vorwarnanzeiger der Autobahnmeistereien,
welche auf einschlägigen Kleinanzeigenportalen oder bei der
VEBEG angeboten werden. Insofern liegt es wie so oft an den
zuständigen Behörden (im Falle der Autobahnen ist dies die
Autobahn-GmbH), für eine einheitliche Verfahrensweise bei der Anwendung von
LED-Vorwarnanzeigern zu sorgen - zumindest wenn es um die
verkehrsrechtlich relevante Abbildung von Verkehrszeichen geht. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Qualität der Darstellung
Qualität der Darstellung
Die fragwürdige Variante von Zeichen 267 wurde bereits
vorgestellt. Es bestehen aber auch andere größere und
kleinere Verfehlungen bei der Umsetzung von Verkehrszeichen
mittels LED-Matrixanzeigen. Viele dieser Kuriositäten liefern
die Hersteller der Anlagen mit der geräteeigenen Bibliothek aus,
andere werden mehr oder weniger gekonnt durch die Anwender
selbst erstellt. In der Folge sehen sich die Verkehrsteilnehmer
inzwischen mit allen möglichen Varianten der jeweiligen Verkehrszeichen
konfrontiert, wobei die Bandbreite lediglich "kosmetische Feinheiten" aber
auch unzulässige Veränderungen mit verkehrsrechtlicher Relevanz
umfasst.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 |
 |
 |
 |
|
amtliches Zeichen
123
Schwarz-Weiß-Umkehr |
adaptierte LED-Darstellung |
Ausführung
Hersteller 1 |
Ausführung
Hersteller 2 |
|
|
| |
|
|
| |
|
Bereits die Varianten von Zeichen
123 zeigen die Unterschiede in der Praxis auf. Das erste LED-Verkehrszeichen
bildet das Sinnbild korrekt ab, wobei kleinere Anpassungen
zugunsten der Erkennbarkeit vorgenommen wurden. Die Ausführung
von Hersteller 1 verdeutlich zwar auch was gemeint ist, weicht
jedoch deutlich vom amtlichen Sinnbild ab. Die Variante von
Hersteller 2 repräsentiert den Versuch zur Nachahmung des Sinnbildes
von Zeichen 123 -
durchaus erkennbar, aber grafisch eher weniger gelungen. Auch
die Wiedergabe des roten Dreiecks erfolgt in allen drei
Beispielen unterschiedlich, wobei die Variante von Hersteller 2
besonders kreativ ausfällt, denn das Ergebnis ist nicht
gleichschenklig und insbesondere die obere Eckausrundung hat mit
der Originalabbildung bzw. der typischen Ausführung von
Gefahrzeichen nicht viel gemein. Alle LED-Gefahrzeichen basieren auf derselben Anzeigefläche (48 x
48 Pixel) - die erste Variante wäre daher auch durch Hersteller
1 und 2 problemlos umsetzbar.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
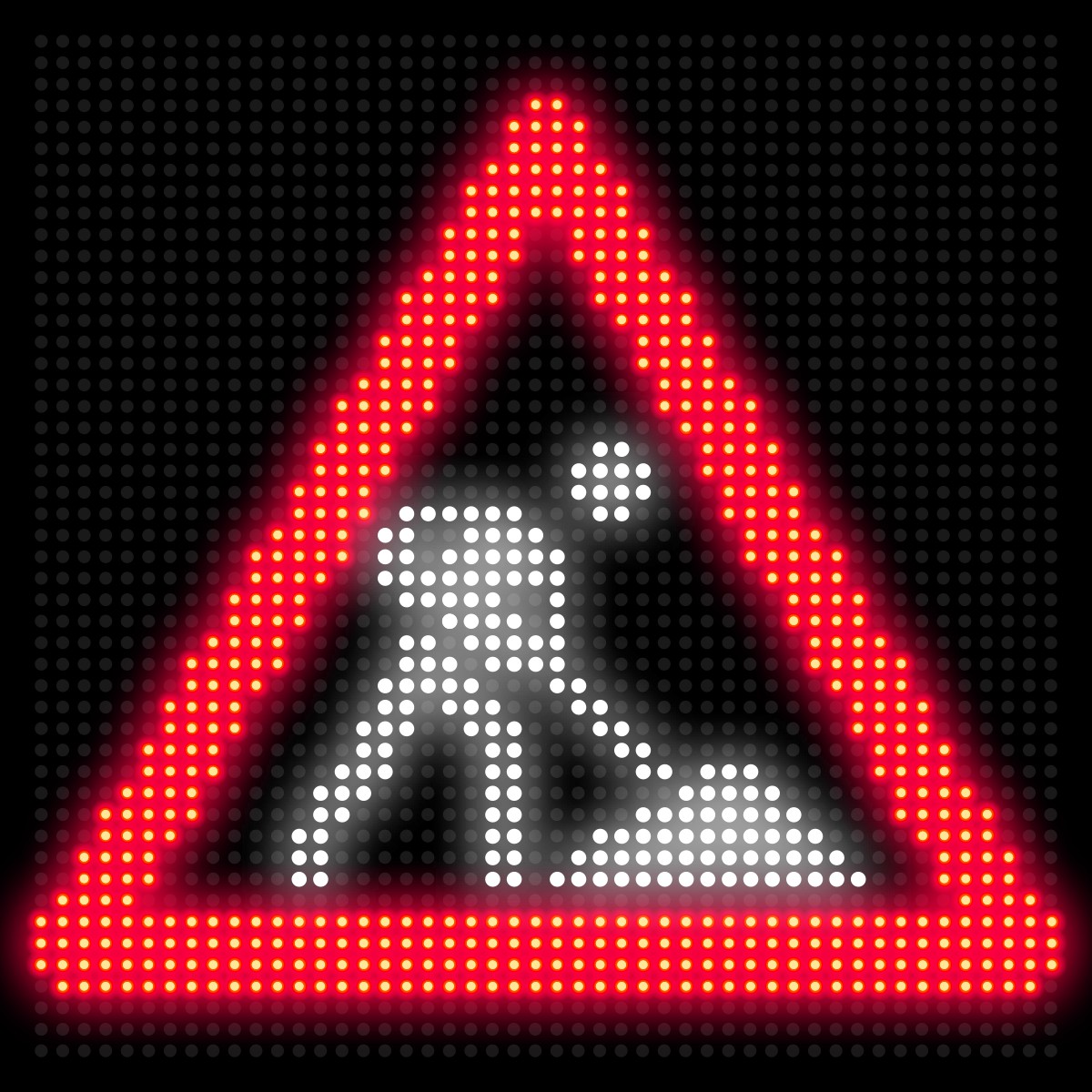 |
 |
 |
 |
|
Weitere Varianten und Abwandlungen
von Zeichen 123 aus der VZ-Bibliothek eines Herstellers. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Die fragwürdigen LED-Varianten
stehen ihren kreativen Vorbildern aus Blech jedoch in nichts
nach.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 |
 |
 |
 |
|
Zeichen
274-80
Schwarz-Weiß-Umkehr |
adaptierte LED-Darstellung |
Ausführung
Hersteller 1 |
Ausführung
Hersteller 2 |
|
|
| |
|
|
| |
|
Auch bei Zeichen 274
bestehen in der Praxis Unterschiede im Vergleich zur amtlichen
Gestaltung des Zeichen 274 in
Schwarz-Weiß-Umkehr (linke
Abbildung). Während die "80" bei Hersteller 1 viel zu groß
ausfällt und zudem dem Schriftstil "fett" entspricht, ist die
"80" von Hersteller 2 in Relation zum roten Rand etwas zu klein
geraten. Dieser ist bei beiden Herstellern mit 5 und 6 Pixeln
viel zu breit, da die sog. Äquivalentfläche (Überstrahlung bei
lichttechnisch erzeugten Verkehrszeichen) nicht berücksichtigt
wurde. Die 8 von Hersteller 1 ist zudem nicht
symmetrisch - genau wie der rote Rand. Die adaptierte LED-Darstellung
repräsentiert dagegen ein ausgewogenes Gesamtbild, was
sich nicht zuletzt auf den Energieverbrauch auswirkt. Auch
darauf kommen wir später noch einmal zurück.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 tatsächlich notwendige Größe der Verkehrszeichen
tatsächlich notwendige Größe der Verkehrszeichen
Im Merkblatt für Tafeln mit lichttechnischem
Informationsteil (M-TI / FGSV-Nr. 342) wird auf die Größenklasse
D gemäß der Richtlinien für Wechselverkehrszeichen an
Bundesfernstraßen (RWVZ) Bezug genommen, aber abweichend davon für Ronden ein Durchmesser von
1000 mm festgelegt.
Dies entspricht bereits nicht den regulären Größen von
konventionellen Verkehrszeichen und ist insbesondere bei einer
seitlichen Aufstellung eher fragwürdig, da überdimensioniert. So haben Dreiecke der
Größe 3 eigentlich eine Seitenlänge von 1250 mm, während Ronden
derselben Größenklasse einen Durchmesser von lediglich 750 mm
aufweisen.
Warum eine lichttechnisch erzeugte
und deutlich besser sichtbare LED-Ronde einen Durchmesser von
1000 mm benötigt, während das LED-Dreieck - maßgeblich auf Grund
der eingeschränkten Breite der Anzeigefläche - mit einer
Seitenlänge von "nur" 1000 mm auskommt (was etwa Schildgröße 2
entspricht), bleibt unklar. Es spricht fachlich jedenfalls
nichts dagegen, wenn man sich bei der Darstellung von Ronden im
oberen Tafelteil eines Vorwarnanzeigers auf die Größe 3 (Ø
750 mm) beschränkt - insbesondere weil
diese "Verkleinerung" auch der Darstellung der Längenangabe zu Zeichen 274 gemäß RSA 21 zuträglich ist.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
Gegenüberstellung Dreieck / Ronde mit etwa identischem
Größenverhältnis wie es bei Blech-Verkehrszeichen gegeben ist. |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Überdimensionierte Darstellung von Zeichen 274-60 mit einem Ø von ca. 1250
mm.
Ein
vergleichbares Blechschild hätte nur einen Ø von 750 mm.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
An dieser Stelle ist bereits die
Anordnung von zwei Gefahrzeichen am selben Standort falsch, denn
Gefahrzeichen werden im Regelfall nicht kombiniert. Zudem soll hier vor Stau gewarnt werden und diese Funktion übernimmt bereits das Zeichen
124, welches man auch als alleiniges Gefahrzeichen auf der Obertafel hätte anzeigen können. Das
Foto soll verdeutlichen, dass die Größe der
angezeigten Verkehrszeichen oft nur zufällig entsteht - je nach
verwendeter Anzeigefläche und Bibliothek. Wenn man schon eine
solche Kombination wählt, dann muss das Zeichen auf der
Untertafel dieselben Abmessungen aufweisen, wie das Schild auf
der Obertafel.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Ein merkwürdiges Größenverhältnis
zwischen Gefahr- und Vorschriftzeichen besteht auch bei einigen
ortsfesten Verkehrsbeeinflussungsanlagen. Im Übrigen ist die
Anzeige von Zeichen 101 ohne Konkretisierung der vorliegenden
Gefahr unzweckmäßig, da für den Verkehrsteilnehmer
unklar bleibt worauf er sich einstellen muss.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Größe der Ziffern von Zeichen 274
Größe der Ziffern von Zeichen 274
Bei der Darstellung von Zeichen 274 ist
inzwischen eine große Variantenvielfalt auf unseren Straßen
anzutreffen, maßgeblich dadurch begründet, dass verbindliche
Festlegungen zur Wiedergabe des Zeichens auf verschiedenen
LED-Matrixanzeigen fehlen. Das als Weiterentwicklung des M-TI
vorgesehene Merkblatt für temporäre Wechselverkehrszeichen
(M-tWVZ) lässt weiter auf sich warten - darum auch dieser
Beitrag. Sowohl die Hersteller als auch die
Anwender basteln oftmals irgendetwas zusammen, was zwar in der
Konsequenz den Regelungswillen abbildet, aber grafisch gesehen
oft einen Fehlgriff darstellt. Dabei ist der Sachverhalt
eigentlich ganz einfach: Man orientiert sich an ortsfesten
LED-Wechselverkehrszeichen:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
|
Bei beiden Schilderbrücken kommen
zur Darstellung der Ziffern von Zeichen 274 nur jeweils eine
Reihe Pixel zur Anwendung. Zwar sind diese nicht rasterförmig
angeordnet sondern gleichmäßig entlang der Mittellinie der Ziffern
verteilt, jedoch
lässt sich dieses Prinzip auch bei LED-Matrix-Schildern
anwenden:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Verkehrsbeeinflussungsanlage mit
LED-Matrix-Wechselverkehrszeichen - also demselben Prinzip, wie
es im Anwendungsbereich der RSA 21 eingesetzt wird. Die 60 wird
ähnlich dem nachfolgend gezeigten Beispiel (linke Abbildung) mit
nur einer Reihe Pixel gebildet und ist in der relevanten
Lesbarkeitsentfernung trotzdem sehr gut erkennbar und entspricht
dabei der Verkehrsschrift nach DIN 1451 Teil 2.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|
|
Zeichen
274-80
Linienstärke: 1 Pixel |
Zeichen
274-80
Linienstärke: 2 Pixel |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Da die Schilder lichttechnisch
erzeugt werden gibt es keinen Grund für eine exakt maßhaltige
Wiedergabe der Strichstärken - diese verbietet sich sogar. In
der relevanten Lesbarkeitsentfernung "verschwimmen" die
Einzelpixel zu einer gemeinsamen Linie, welche breiter erscheint
als sie tatsächlich ist. Entsprechend wird auch der rote Rand im
Falle der beiden zuerst gezeigten Schilderbrücken aus lediglich zwei
Ringen mit jeweils 1 Pixel Linienstärke gebildet. Trotzdem -
oder gerade deshalb - sind die Schilder als Zeichen 274
problemlos zu erkennen und entsprechen dabei auch geometrisch
bzw. typografisch der amtlichen Variante nach StVO:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Ansicht im Nahbereich: Eine
Linienstärke für die Ziffern und zwei Linienstärken für den
roten Rand genügen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|
|
Detailansicht eines ortsfesten
LED-Wechselverkehrszeichens |
Die
Umrandung gemäß Zeichen 250 zeigt
wie das Zeichen aus der Entfernung wirkt |
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Andere Anlage, identisches Prinzip:
Sinnbilder und Ziffern bzw. Text mit je 1 Pixel, roter Rand mit
2 Pixel Linienstärke.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Allerdings bedeutet "zwei rote Ringe
mit je 1 Pixel Linienstärke" nicht, dass bei der Erstellung der
Zeichen am PC lediglich ein Ring mit 2 Pixel Linienstärke
ausreichend ist (vgl. M-Ti), da in diesem Fall der Zwischenraum zwischen den
beiden Ringen fehlt. Entsprechend empfiehlt sich beim roten Rand
eine Stärke von drei Pixeln, wobei dies auch immer in Relation
zur Größe der Anzeigefläche und deren Auflösung zu bemessen ist. Ziel muss eine
möglichst exakte Darstellung der Verkehrszeichen sein, welche
der Originalabbildung nach StVO in der relevanten
Lesbarkeitsentfernung entspricht. Hierzu noch einmal
Varianten aus der Praxis, die diese Anforderung nicht oder nicht
vollumfänglich erfüllen:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
Varianten der Hersteller / Dienstleistungsunternehmen. Die
rechte Abbildung entspricht dem M-TI, ist aber ebenfalls
verbesserungswürdig.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Temporäres LED-Wechselverkehrszeichen mit einer
Linienstärke von 1 Pixel (Weiß), allerdings nicht als Matrix
sondern in LED-Kettentechnik. |
|
|
| |
|
|
| |
|
Randbreite von Gefahr- und
Vorschriftzeichen mit rotem Rand
Sofern Verkehrszeichen auf LED-Matrixanzeigen
entsprechend der regulären Schildergröße 2 bzw. 3 dargestellt
werden, ergibt sich eine Randbreite von 3 bis 4 Pixeln. Wie
beschrieben gibt es fachlich gesehen keinen Grund, Ronden mit
einem Durchmesser von 1250mm darzustellen, nur weil die
Anzeigefläche dies ermöglicht.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
LED-Wechselverkehrszeichen mit einer
Linienstärke von 2 Pixeln für die Ziffer und einem dazu passenden
Rand, wobei dessen Durchmesser in Relation zur Schrift wie
üblich etwas zu groß geraten ist. Die Darstellung der "80"
müsste
zudem noch besser an die DIN 1451 Teil 2 angeglichen werden. |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Darstellung von Pfeilen
Darstellung von Pfeilen
Die Wiedergabe der Pfeile auf Fahrstreifen- bzw.
Verkehrslenkungstafeln erfolgt ebenfalls nicht einheitlich.
Neben
einer weitgehend identischen Nachbildung des für diese
Verkehrszeichen üblichen Herzpfeils ist vor allem die
vereinfachte Darstellung als Dreieck üblich und natürlich werden
auch Anlagen eingesetzt, bei denen die Pfeilspitze einem Iso-Pfeil entspricht.
Oft werden Bibliotheken aus anderen
europäischen Ländern genutzt und die dort üblichen
Pfeile übernommen. Zwar sind alle Varianten zweifellos als
Pfeile erkennbar, allerdings ist auch in diesem Fall eine
einheitliche Ausführung erforderlich, welche sich an der
Gestaltung der entsprechenden Originalabbildungen gemäß VzKat orientiert:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
|
adaptierte LED-Darstellung |
Ausführung Hersteller 1 |
Ausführung Hersteller 2 |
Ausführung Hersteller 3 |
|
|
| |
|
|
| |
|
Eine klar erkennbare und
systematisch idealisierte Variante stellt die erste Abbildung
ganz links dar. Der Pfeilschaft hat eine Breite von lediglich
zwei Pixeln, was insbesondere der Darstellung von mehr als drei
Fahrstreifen zu Gute kommt. Wie beschrieben ergibt sich die
tatsächliche Breite in der relevanten
Lesbarkeitsentfernung durch die lichttechnisch
bedingte Überstrahlung der einzelnen Pixel. Es gibt also keinen Grund, die üblichen
6 cm Schaftbreite auf die tatsächliche Pixelbreite (4 Pixel bei
20 mm Raster) zu übertragen. Durch eine Schaftbreite von lediglich 2 Pixeln
ergeben sich auch grafische Vorteile bei der Abbildung von
Fahrstreifenverschwenkungen.
Die Pfeilspitzen im ersten Beispiel entsprechen weitgehend der Herzform und zwar sowohl in
Geradeausrichtung als auch beim Fahrstreifeneinzug. Insbesondere
diese Anforderung wird durch die Varianten der Hersteller
bislang nicht exakt umgesetzt. Zwar entsteht im Nahbereich eine
Art "schräger Tannenbaum", in der relevanten Lesbarkeitsentfernung ist
dies aber ebenfalls nicht relevant.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
LED-Vorwarnanzeiger mit
Iso-Pfeilspitzen anstelle der in Deutschland auf Fahrstreifen-
und Verkehrslenkungstafeln üblichen Herzpfeil-Darstellung.
Und wenn wir durchzählen kommen wir auf insgesamt vier
Fahrstreifen und nicht wie abgebildet drei. Tatsächlich entfällt
auf dieser Strecke 500 m nach dem Vorwarnanzeiger zunächst der rechte von vier Fahrstreifen und
weitere 200 m später der linke. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Auch am zweiten Vorwarnanzeiger wäre
zusätzlich der Einzug des rechten der vier Fahrstreifen
anzuzeigen. |
|
|
| |
|
|
| |
|
Gestaltung und Abstand benachbarter Pfeile
Die Adaption von "geschwungenen" Fahrstreifen auf
Verschwenkungstafeln erfolgt bei den meisten Anlagen nur bedingt,
denn oftmals knickt der Pfeilschaft einfach im Winkel von 45°
ab, obwohl sich beim amtlichen Verkehrszeichenbild an dieser
Stelle ein Radius
befindet. Diese Abstraktion mag für die Erstellung der Grafiken
zweckmäßig sein, da sich der Aufwand reduziert, das Ergebnis
ist grafisch gesehen aber eher nicht zufriedenstellend.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Werden auf LED-Vorwarnanzeigern und
teilstationären LED-Wechselverkehrszeichen Pfeile mit Radien dargestellt so
entspricht das Resultat oftmals trotzdem nicht dem amtlichen Muster. Ein
diagonal verlaufender Pfeilschaft wird dann gern zu schmal oder zu
breit dargestellt, wie die nachfolgende Abbildung ganz links
zeigt:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
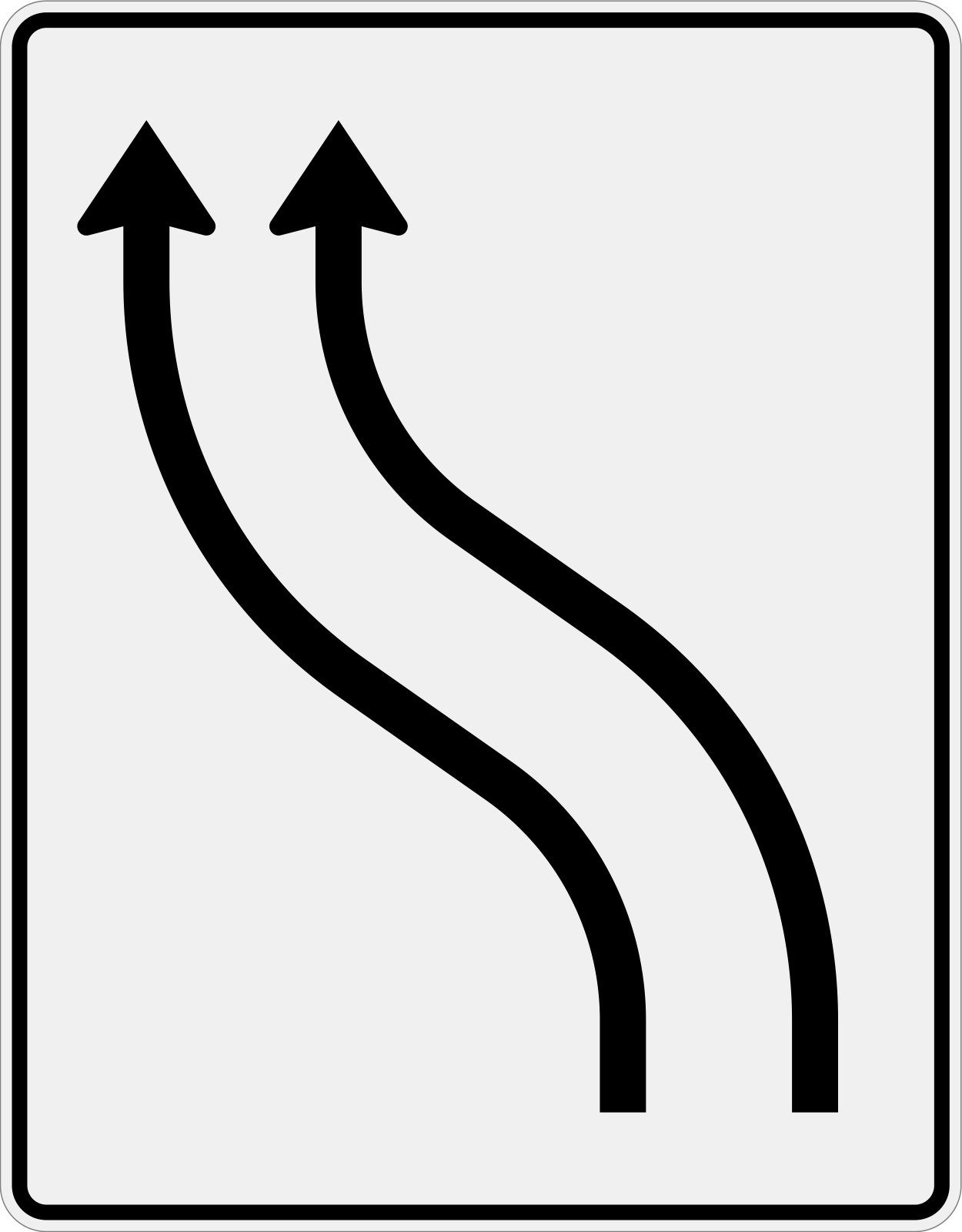 |
 |
|
|
|
Variante eines Herstellers |
Zeichen 511-11 gemäß VzKat |
adaptierte LED-Darstellung |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die links abgebildete Variante enthält
aber noch einen weiteren Fehler und der ist auch bei der Anfertigung
konventioneller Verkehrslenkungstafeln anzutreffen: Werden mehrere
Fahrstreifen benötigt, wird ein identischer Pfeil einfach
kopiert und daneben wieder eingefügt. Tatsächlich sind aber die
verschwenkten Pfeile einer Verkehrslenkungstafel alle
unterschiedlich ausgebildet, weil die Pfeilschäfte immer im gleichen Abstand
parallel zueinander verlaufen:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
Zeichen
511-12 gemäß VzKat |
alle
drei Pfeile sind unterschiedlich |
Falsch: Dreimal derselbe Pfeil |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Bei der rechten Abbildung wurde der
mittlere Pfeil aus der Originalvorlage kopiert und jeweils links
und rechts daneben eingefügt. Der Abstand zwischen den
Fahrstreifen verringert sich folglich in der Mitte des Schildes
und wird danach wieder breiter. Die mittlere Abbildung
verdeutlicht die unterschiedliche Ausführung der Pfeile beim
originalen Zeichen 511-12.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Die Anforderungen des VzKat und der
RAL-Gütebedingungen sind graue Theorie. In der Praxis ist
dagegen oft Freestyle angesagt - egal ob Blech oder LED.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Quadrate und Kreuzchen - überflüssig und
unzulässig
LED-Wechselverkehrszeichen dienen in erster Linie
zur lichttechnischen Darstellung der amtlichen Verkehrszeichen,
verbunden mit der Option, auf derselben Anzeigefläche
unterschiedliche Schilder anzeigen zu können. Die Flexibilität
der Anlagen fördert allerdings auch die Kreativität der Anwender
und das zeigt sich in Darstellungen, die nicht in der
StVO vorgesehen sind. Dazu zählen z.B. rote Kreuze oder weiße
und rote Quadrate, welche natürlich bereits herstellerseitig in
den Bibliotheken angelegt sind:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
Ausführung Hersteller 1 |
Ausführung Hersteller 2 |
Ausführung Hersteller 3 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Teilweise werden auch die vor
fahrbaren Absperrtafeln ausgelegten Warnschwellen auf
LED-Vorwarnanzeigern dargestellt und manch einer hält sogar die
Abbildung von Leitkegeln oder Leitbaken für sinnvoll. Maßgebend
sind jedoch allein die StVO sowie der VzKat und
darin sind derartige Spielereien schlichtweg nicht vorgesehen.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Für die Abbildung von Kreuzen oder
Quadraten zur Symbolisierung des gesperrten Fahrstreifens
besteht in Deutschland weder ein Erfordernis, noch eine Rechtsgrundlage. Sofern
diese Art der Darstellung als sinnvoll erachtet wird, wäre sie
als Bestandteil der regulären Fahrstreifen- und
Verkehrslenkungstafeln in den VzKat aufzunehmen und in der Folge
auch auf den entsprechenden Blechschildern abzubilden. Diese Änderung
bleibt aber hoffentlich aus. |
|
|
| |
|
|
| |
|
Bundesweit tätige Dienstleistungsunternehmen
berichten davon, dass - je nach Zuständigkeitsbereich und
Auffassung der Verantwortlichen vor Ort - die roten Kreuze oder
Quadrate unbedingt angezeigt werden müssen und dass sie in einer
anderen Region Deutschlands für die Verwendung derselben
Darstellung gerügt werden. Wie üblich gibt es natürlich auch
Gegenden, in denen im Grunde alles egal ist. Entsprechend ist
auch in dieser Sache eine einheitliche Verfahrensweise notwendig
und hierfür bilden allein der VzKat sowie die StVO die entsprechende Grundlage.
Solange auf konventionellen Fahrstreifen- und
Verkehrslenkungstafeln keine derartigen Inhalte dargestellt
werden, verbietet sich auch deren Wiedergabe auf
LED-Vorwarnanzeigern oder teilstationären Anlagen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Animierte Darstellungen
Animierte Darstellungen
Wiederkehrende Diskussionen gibt es auch
bezüglich der animierten Wiedergabe von Fahrstreifen- und
Verkehrslenkungstafeln. Gemäß StVO ist eine derartige
Darstellung natürlich nicht vorgesehen, allerdings kann sich
eine grafisch sinnvolle Umsetzung durchaus positiv auf die
Wahrnehmung des Verkehrsteilnehmers auswirken. Ob man mit Hilfe
animierter Fahrzeuge (auf dem grafischen Niveau der Arcade
Spiele der frühen 1980er Jahre) das Reißverschluss-Prinzip
verdeutlichen muss,
darf bezweifelt werden. Die dynamische Wiedergabe von
Fahrstreifenreduzierungen oder Verschwenkungen durch animierte
Pfeile ist dagegen regelmäßig nicht
zu beanstanden. Die zuständige Behörde kann jedoch auf die statische Wiedergabe des Verkehrszeichenbildes bestehen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Bei den meisten Anlagen ist die Qualität der
Animationen in der Regel verbesserungswürdig, was sowohl die
allgemeine Darstellung der Verkehrszeichen gemäß
VzKat, als auch die Zusammenstellung der jeweiligen Sequenz
betrifft. Als Beispiel soll die dynamische Wiedergabe einer
Fahrstreifentafel dienen:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
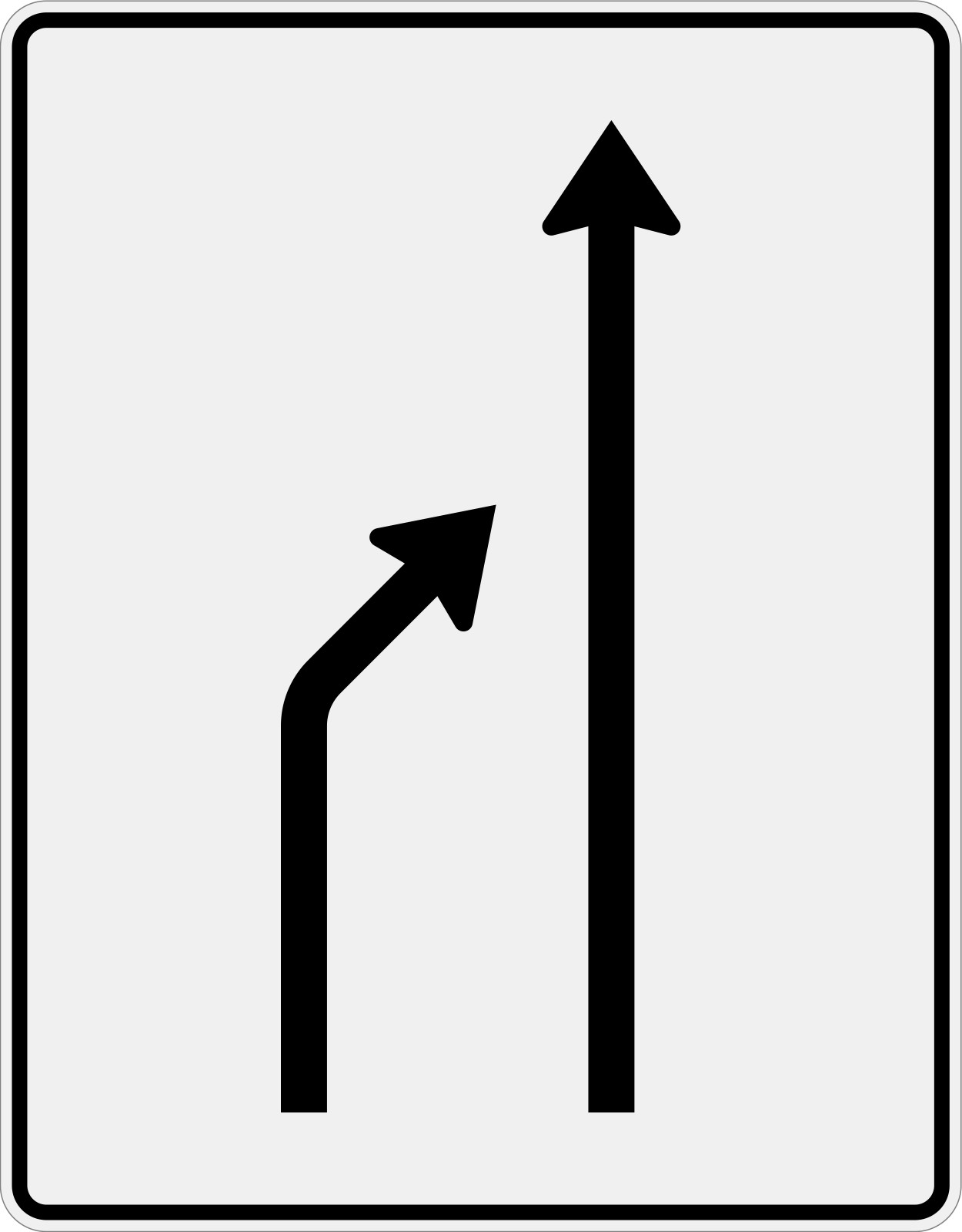 |
|
|
|
Animierte Darstellung - Hersteller 1 |
letztes Bild der Sequenz |
Zeichen 513-20 gemäß VzKat |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Wie üblich entspricht die finale
Abbildung (letztes Bild der Sequenz) nur bedingt dem
amtlichen Zeichen 513-20, insbesondere weil die Pfeile
miteinander verschmelzen. Eigentlich müsste die Pfeilspitze des
eingezogenen Fahrstreifens etwa 5 Pixel vom Pfeilschaft des
Geradeauspfeils entfernt sein. Die Sequenz umfasst zudem
hauptsächlich den "aufsteigenden" linken Fahrstreifen, der
eigentliche Fahrstreifeneinzug - als wichtigste Information -
erhält dagegen lediglich zwei Bilder, wobei das letzte Bild auch
sehr schnell wieder verschwindet, da die Sequenz sofort von vorn
beginnt. Stattdessen müsste das letzte Bild noch etwas länger
stehen bleiben und die Sequenz müsste auch kurzzeitig nur die
Anzeige des Geradeauspfeils beinhalten, bevor der Ablauf erneut
startet. Das Ergebnis würde dann so aussehen:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
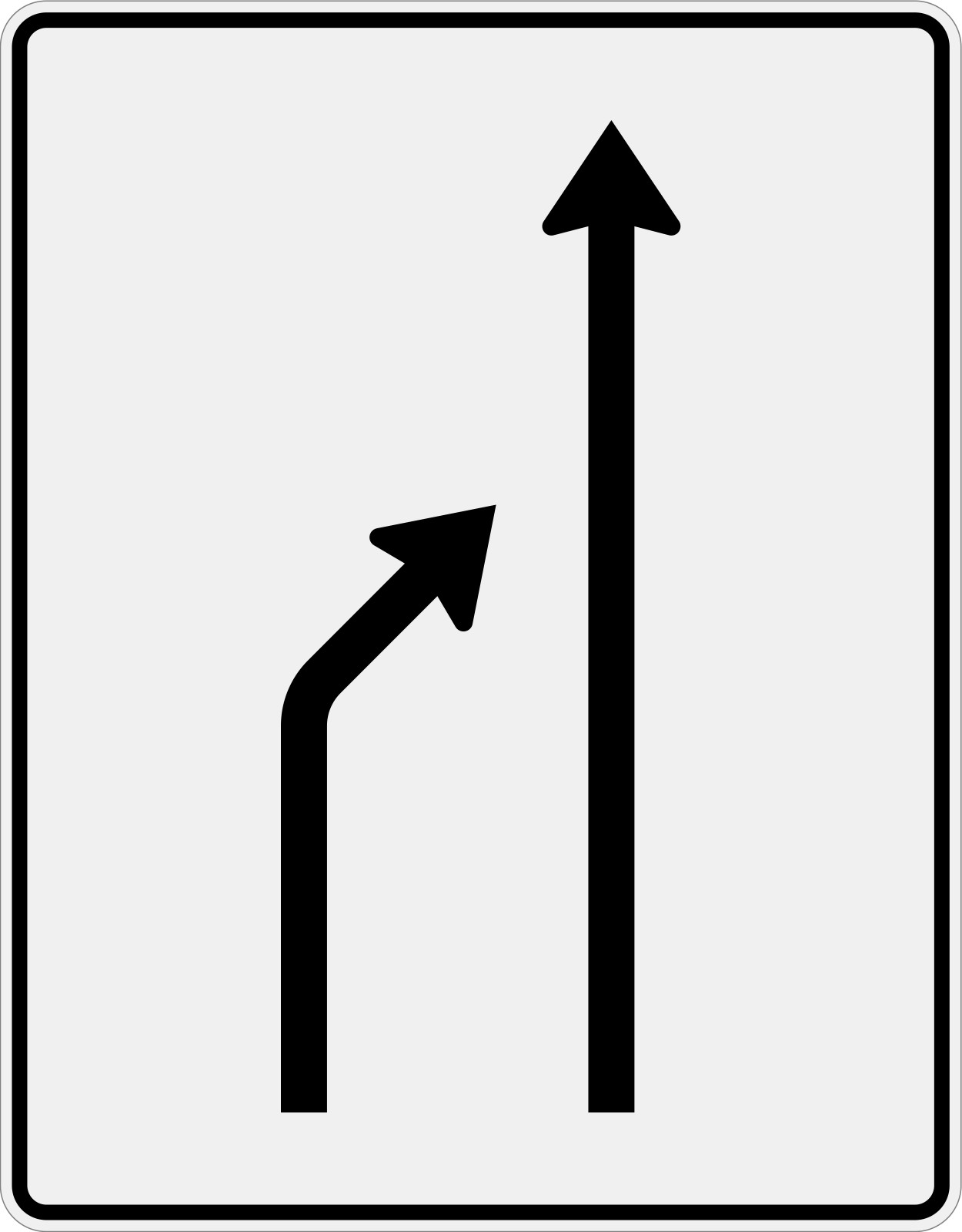 |
|
|
|
verbesserte Darstellung |
letztes Bild der Sequenz |
Zeichen 513-20 gemäß VzKat |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Dieses Prinzip ist bei allen
animierten Fahrstreifen- und
Verkehrslenkungstafeln umzusetzen, wobei der Fokus auf der
korrekten Darstellung des jeweiligen Verkehrszeichens (letztes
Bild der Sequenz) liegen muss. Die Anzeigegeschwindigkeit ist
zudem so zu wählen, dass das Ergebnis weder hektisch wirkt
oder in Zeitlupe abläuft.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Auch bei diesem LED-Vorwarnanzeiger
laufen die Pfeile ineinander und das letzte Bild der Sequenz
entspricht nur bedingt dem Zeichen 513-20.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
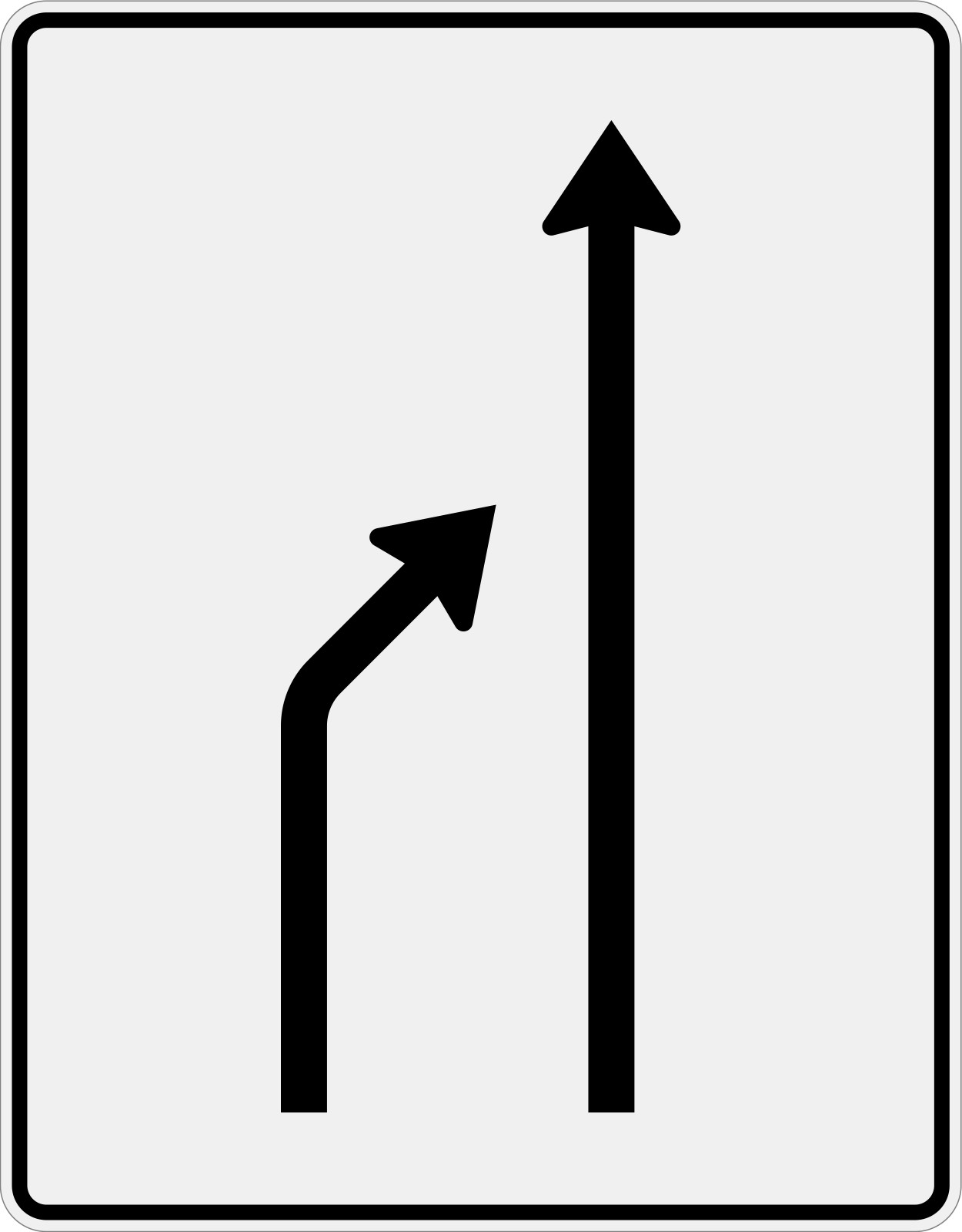 |
|
|
|
Animierte Darstellung - Hersteller 2 |
letztes Bild der Sequenz |
Zeichen 513-20 gemäß VzKat |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Verkehrszeichen auf
Fahrstreifen-Pfeilen
Verkehrszeichen auf
Fahrstreifen-Pfeilen
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Auf dem linken Fahrstreifen gilt
offenbar eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf maximal 2,1 km/h, was der
aktuellen Reisegeschwindigkeit beim vorhandenen Stau entspricht - schließlich
wurde "Zeichen 274" abgebildet. Tatsächlich soll das natürlich ein
Zeichen 264-2,1 (Verbot für Fahrzeuge mit einer tatsächlichen
Breite über 2,1 m) sein, aber dafür fehlen sowohl die
beidseitigen Pfeilspitzen, als auch die Maßeinheit "m".
Die
Darstellung des "PKW" ist in dieser Gestaltung zwar grafisch
sinnvoll aber verkehrsrechtlich falsch, da dieses Sinnbild
üblicherweise "Kraftwagen und sonstige mehrspurige Fahrzeuge"
bedeutet und folglich auch "LKW" umfasst. Die Rückansicht des
"LKW" wiederum ist nur bei Zeichen 277 mit "Fahrzeugen mit einer zulässigen
Gesamtmasse über 3,5t..." definiert aber ansonsten nirgends
geregelt. In der Gesamtbetrachtung handelt es sich bei diesem
Schild um einen
durchaus sinnvollen Hinweis aber eben nicht um ein
Verkehrszeichen nach StVO.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Bei dieser LED-Tafel werden im
Zeichen 264 zwar die beidseitigen Pfeilspitzen und die Einheit
"m" angezeigt, das dadurch größere Vorschriftzeichen musste hierfür jedoch deutlich vom
Fahrstreifen abgerückt werden, damit es nicht gleichzeitig den
daneben liegenden Pfeil betrifft. Dieser wurde wie oben
beschrieben einfach kopiert, so dass der Abstand gerade an der
relevanten Stelle deutlich schmaler wird. Die Problematik mit
der Bedeutung der Sinnbilder ist auch hier gegeben.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
In beiden Fällen hätte man die
relevanten Inhalte durch grafische Anpassungen etwas besser abbilden
können, allerdings sind die Möglichkeiten dann auch schnell
ausgereizt. Bei der Planung derartiger Tafeln müssen daher immer die
technischen Grenzen der Darstellung berücksichtigt werden, denn
auf einer Anzeigefläche mit einer Auflösung
von 64 x 80 oder 96 Pixel sind grafisch anspruchsvolle Abbildungen
schlichtweg nicht umsetzbar.
Das ist vergleichbar mit dem
bewährten Problem, dass für klassische Umleitungs-Planskizzen eine
Schriftgröße von 126 mm oder größer gefordert wird, wobei der
Inhalt grafisch einer Landkarte entsprechen soll, aber im
Leistungsverzeichnis sind natürlich nur Tafeln der Standardgröße
1250 x 1600 mm enthalten. Ein Prinzip, welches bereits bei
Blechschildern nicht funktioniert, wird nunmehr 1:1 bei
LED-Wechselverkehrszeichen angewandt und da fällt als Konsequenz
mal eben die Einheit in einem Verkehrszeichen weg. "Man sieht ja
was gemeint ist."
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Der Verzicht auf die Einheit in Zeichen
264 ist allerdings auch bei konventionellen Verschwenkungstafeln
anzutreffen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Wiedergabe von Sinnbildern /
Piktogrammen
Wiedergabe von Sinnbildern /
Piktogrammen
Die unzureichende Auflösung
macht sich insbesondere bei der Wiedergabe von Sinnbildern und
Piktogrammen bemerkbar. Zwar versuchen sowohl die Hersteller als
auch die Dienstleistungsunternehmen auf der beschränkten
Anzeigefläche selbst kleinste PKW- oder LKW-Sinnbilder
darzustellen, allerdings entspricht das Ergebnis oft
einer Zeichnung aus dem Kindergarten - nur eben realisiert in
Pixeln:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
Varianten aus der Praxis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
amtliche Sinnbilder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
adaptierte LED-Darstellung |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Bei der Gestaltung von
KFZ-Sinnbildern als seitliche Darstellung sind zunächst die
Räder maßgebend. Ein halbwegs erkennbarer Kreis benötigt
eine Fläche von mindestens 4 x 4 Pixel (untere Abbildung der LED-Adaption),
besser sind jedoch mindestens 5 x 5 Pixel. Das Ergebnis muss
jedenfalls in der relevanten Lesbarkeitsentfernung als Kreis erkennbar sein. Auf dieser Grundlage
erfolgt dann die proportionale Umsetzung des restlichen
Fahrzeugs in Referenz zum amtlichen Sinnbild. Die in der unteren
Reihe abgebildeten Piktogramme repräsentieren die
Mindestanforderungen für eine sinnvolle Gestaltung gemäß VzKat.
Während eine Vergrößerung meist problemlos realisierbar ist,
geht eine verkleinerte Abbildung in der Regel mit deutlichen
grafischen Abstrichen einher - beginnend mit eckigen Rädern.
Zwar sind alle in der oberen Reihe gezeigten Sinnbilder durchaus
noch verständlich, dennoch ist fraglich ob dies als Stand der
"modernen" LED-Technik bezeichnet werden darf. Niedlich oder
putzig ist nicht gleichbedeutend mit amtlich.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Noch erkennbare aber grafisch
bereits grenzwertige Gestaltung eines Zeichen 1049-13. Übliches
Problem: Anzeigefläche zu klein bzw. Auflösung zu grob. |
|
|
| |
|
|
| |
|
Vom Sinnbild zum Vorschriftzeichen
Die Räder sind wie beschrieben Ausgangspunkt für das Sinnbild und
dieses ist wiederum Grundlage für das entsprechende
Vorschriftzeichen, insbesondere bei der Abbildung auf dem
Pfeilschaft einer Fahrstreifen- oder Verschwenkungstafel.
Spätestens bei dieser Anwendung zeigen sich die Defizite der
groben Auflösung heutiger LED-Wechselverkehrszeichen, denn die
auf konventionellen Schildern übliche Größe lässt sich via
LED-Matrix oft nicht darstellen:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 |
 |
 |
|
Mini-Variante mit stark
abstrahiertem Sinnbild |
erforderliche Größe
des Vorschriftzeichens
aus dem Sinnbild heraus entwickelt |
LED-Matrix gleicher Größe jedoch mit einer
Auflösung von 128 x 160 Pixel mit 10mm Abstand |
|
|
| |
|
|
| |
|
Die rechte Abbildung verdeutlicht,
dass zur Darstellung von kleinen
Verkehrszeichen und Sinnbildern eine höhere Auflösung
erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für Tafeln auf denen
mehr als drei Fahrstreifen angezeigt werden müssen. Durch
Verkleinerung des Pixelabstandes auf 10mm und einer Auflösung
von 128 x 160 Bildpunkten für Tafeln in Standardgröße, sind im Grunde alle erforderlichen
Inhalte ohne Kompromisse darstellbar. Ideal wäre natürlich das
eingangs beschriebene Modul-System nach dem Vorbild der
Veranstaltungstechnik, so dass beispielsweise eine Tafel mit den
Maßen 1500 x 2000 anwendungsbezogen erstellt werden kann. |
|
|
| |
|
|
| |
|
Darstellung von Sinnbildern als Umriss
Bei der Abbildung von
Sinnbildern wird auf Wechselverkehrszeichen oft nur der Umriss
nachgezeichnet, obwohl diese Art der Darstellung streng genommen
nicht der StVO entspricht. Diese zusätzliche Abstraktion hat
ihren Ursprung in der Lichtfasertechnik.
Die zu dieser Zeit entwickelte Gestaltung wurde dann bei der
Umstellung auf LED einfach übernommen - maßgeblich bei
Wechselverkehrszeichen die auf LED-Kettentechnik basieren:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 |
 |
 |
 |
|
Zeichen 277
Schwarz-Weiß-Umkehr |
Variante Hersteller 1
in LED-Kettentechnik |
Variante Hersteller 2
in LED-Kettentechnik |
Variante Hersteller 3
in Lichtfasertechnik |
|
|
| |
|
|
| |
|
Bereits die drei Abbildungen zeigen
die Variantenvielfalt lichttechnisch erzeugter Verkehrszeichen
auf unseren Straßen. Im Anwendungsbereich von
LED-Matrix-Verkehrszeichen sind auf Grund der freien
Programmierbarkeit natürlich noch ganz andere
Gestaltungsvarianten möglich: |
|
|
| |
|
|
| |
|
 |
 |
 |
 |
|
Variante Hersteller 4 |
Variante gemäß M-Ti |
Variante Hersteller 5 |
Variante Hersteller 6 |
|
|
| |
|
|
| |
|
Von der bloßen Umrandung (Hersteller
4) über eine "gedimmte" Wiedergabe des "LKW"-Sinnbildes (M-Ti) ist
auch die vollflächige Darstellung der Sinnbilder üblich
(Hersteller 5 und 6). Alle abgebildeten Varianten entsprechen
dabei nach Bekunden der Hersteller zwar den lichttechnischen
Anforderungen der DIN EN 12966, aber je nach grafischer Qualität nur
bedingt dem Zeichen 277 nach StVO. Die Darstellungen von
Hersteller 3 und 6 enthalten dabei sogar einen typischen Fehler,
welcher in der Verkehrssicherungsbranche bereits auf
Blechverkehrszeichen üblich ist: |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Zeichen 277 in der korrekten
Ausführung (rechts) und typische Bastelarbeit in der
Verkehrssicherungsbranche (links) auf Grundlage eines Zeichen
276. |
|
|
| |
|
|
| |
|
 |
 |
 |
 |
|
Zeichen 276
gemäß StVO |
fehlerhafte Änderung
von Z 276 in Z 277 |
Zeichen 277
gemäß StVO |
fehlerhafte Änderung
von Z 277 in Z 276 |
|
|
| |
|
|
| |
|
Um ein Zeichen 277 für den
temporären Einsatz "herzustellen", wird der rote "PKW" auf
Zeichen 276 entfernt und einfach auf derselben Höhe durch einen "LKW"
ersetzt. Beim amtlichen Zeichen 277 sitzen beide Sinnbilder
dagegen etwas weiter unten im Schild. Doch auch die umgekehrte
Variante ist möglich: Bei einem Zeichen 277 wird der rote "LKW"
einfach durch einen roten "PKW" ersetzt, mit der Folge, dass
sich beide Sinnbilder in der unteren Hälfte des Verkehrszeichen
befinden. Beide Ausführungen entsprechen natürlich nicht den
RAL-Gütebedingungen, obwohl diese auch für Verkehrszeichen an
Arbeitsstellen gelten. Aber das ist ein Thema für sich. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Zeichen 276 in der korrekten
Ausführung (rechts) und typische Bastelarbeit in der
Verkehrssicherungsbranche (links) auf Grundlage eines Zeichen
277. |
|
|
| |
|
|
| |
|
Auch wenn es sich bei den genannten
Abweichungen eher um marginale Unterschiede handelt, sind diese
bei der Darstellung der Zeichen 276 und 277 auf
LED-Wechselverkehrszeichen zu berücksichtigen. In diesem
Zusammenhang wären im künftigen
Merkblatt für temporäre
Wechselverkehrszeichen (M-tWVZ) Festlegungen zur korrekten
Abbildung der Zeichen auf verschiedenen Anzeigeflächen zu
treffen. Dies betrifft sowohl die grundsätzliche Darstellung der
Sinnbilder (die aktuelle Abbildung im M-Ti ist dafür
ungeeignet) und die Klärung der Frage, ob die Sinnbilder
ausgefüllt dargestellt werden oder nicht.
Dies betrifft u.a. auch das Zeichen
124, weshalb wir uns auf einen kleinen
Ausflug in die Welt der Stauwarnanlagen begeben: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
Verschiedene Varianten von Zeichen
124 aus der Praxis. Auch für diese LED-Verkehrszeichen ist eine
Vereinheitlichung gemäß StVO / VzKat erforderlich. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Ausführung des Zeichen 124 gemäß
M-Ti, wobei die beiden Schenkel des Dreiecks im Vergleich zur
Basislinie breiter wirken. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Ausführung des Zeichen 124 in
Anlehnung an die früheren lichtfasertechnischen Wechselverkehrszeichen,
jedoch in LED-Technik. |
|
|
| |
|
|
| |
|
Eine Vereinheitlichung ist
allerdings nicht nur bei den Sinnbildern erforderlich, sondern
auch bei der Realisierung der Stauwarnung selbst. Unabhängig von
der konkreten technischen Ausführung (LED-Wechselverkehrszeichen
oder Prismenwender) ist im Grunde immer ein
Wechselverkehrszeichen-System vorzusehen, mit welchem
situationsbezogen vor Staugefahr oder Stau gewarnt werden kann.
Natürlich ist die Praxis auf unseren Autobahnen auch
diesbezüglich alles andere als einheitlich, so dass es auch für
die Stauwarnung eine Low-Budget-Lösung gibt:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Ausführung des Zeichen 124 gemäß
StVO, aber ein "Stauwarnsystem" aus der Steinzeit. Und selbst
diese Art der Umsetzung erfolgt nicht einheitlich: |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
Fragwürdige Ausführungen einer konventionellen Beschilderung zur
Stauwarnung |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die Zeichen 123 und 124 werden oft
unzulässig am selben Pfosten oder zusammen auf einer Trägertafel
kombiniert und durch ein vermeintlich für beide Schilder
geltendes Zusatzzeichen ergänzt. Im oben gezeigten Foto sind die
Zeichen 124 und 123 zwar räumlich getrennt, was aber ebenfalls
keine fachgerechte Lösung darstellt, da das Zeichen 124 vor Stau
in 6 km Entfernung warnt, obwohl dieser bereits 1 km nach dem
Schild beginnen kann. Selbst als Rückfallebene für elektronische
Stauwarnanlagen wäre diese Lösung falsch.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Ein Zusatzzeichen bezieht sich auch
dann nicht auf zwei darüber befindliche Gefahrzeichen, wenn es
auf einer gemeinsamen Trägertafel abgebildet wird. Die statische
Warnung vor Stau auf einer Länge von 4 km ist zwar nicht
zeitgemäß aber durchaus zulässig, das Zeichen 123 ist hingegen
fehl am Platz und in diesem Kontext nicht anordnungsfähig. Wenn
man schon auf eine solche Lösung zurückgreift, dann wird diese
nur mit Zeichen 124 beschildert, die Zeichen 123 folgen dagegen erst
mit der regulären Beschilderung der eigentlichen Arbeitsstelle
(vgl. Regelpläne RSA 21 Teil D).
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Besonders fragwürdig ist die
Low-Budget-Lösung, wenn sie zusätzlich mit gelben
Vorwarnleuchten ausgestattet ist. Der Verkehrsteilnehmer
verbindet mit blinkenden Leuchten über "echten" Stauwarnanlagen
(LED-Wechselverkehrszeichen oder Prismenwendern) eine situative
Warnung vor Stau oder Staugefahr. Wenn eine Warnleuchte jedoch
permanent blinkt, ohne dass die angezeigte Gefahr tatsächlich
besteht, wird das sinnvolle System der aktiven Stauwarnung
konterkariert.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
In diesem Zusammenhang noch
einmal der Hinweis, dass die alleinige Anordnung von Zeichen 101
unzweckmäßig ist. Im Falle einer Stauwarnanlage ist deshalb das
Zusatzzeichen bzw. der Zusatztext "Staugefahr" erforderlich -
unabhängig davon ob es sich um einen Prismenwender oder ein
LED-Wechselverkehrszeichen handelt. Damit zurück zum
eigentlichen Thema.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Autobahn- und Bundesstraßennummern
Autobahn- und Bundesstraßennummern
Die Abbildung von Autobahn- oder
Bundesstraßennummern über den Pfeilspitzen von Fahrstreifen- und
Verschwenkungstafeln hat sich an Arbeitsstellen im Bereich von Autobahnkreuzen und -Dreiecken
sowie an Anschlussstellen bewährt. Insbesondere bei einer
baulichen Trennung von Fahrstreifen, welche im weiteren Verlauf auf eine andere Autobahn oder ins
nachgeordnete Netz führen, ist dieser Hinweis sehr wichtig, damit sich
die Fahrzeugführer rechtzeitig einordnen. Was bei Blechschildern
seit Jahren Standard ist, wird folglich auch mit
LED-Wechselverkehrszeichen umgesetzt:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Das Foto verdeutlicht das
Problem der groben Auflösung heutiger
LED-Wechselverkehrszeichen. Es besteht je nach System die
Gefahr, dass die benachbarten Farben Weiß und Blau in der
Entfernung zu einem hellblauen Rechteck
"verschwimmen", wodurch die Erkennbarkeit der
Autobahnnummer leidet. Die Ziffern sind zudem stark abstrahiert
und damit weit entfernt von der DIN 1451 Teil 2. Der Stand der Technik
ist auch in diesem Fall eher ein Kompromiss.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Bei dieser LED-Schilderbrücke
erfolgt die Wiedergabe der Autobahnnummern deutlich besser
- allerdings entspricht bereits die Größe der Zeichen 405 der
verfügbaren Gesamtbreite üblicher LED-Wechselverkehrszeichen an
Arbeitsstellen. Entsprechend ist bei mobilen oder teilstationären
Anlagen eine Verbesserung der Auflösung unausweichlich, wenn sie
detaillierte Inhalte wiedergeben sollen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
Varianten von Zeichen 401 |
Varianten von Zeichen 405 |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Wegweiser mit LED-Einsätzen im
Bereich einer Bundesstraße.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Wiedergabe von Schriftzeichen / Text
Wiedergabe von Schriftzeichen / Text
Gemäß VwV-StVO ist im Straßenverkehr die
Verkehrsschrift nach DIN 1451 Teil 2 zu verwenden. Das M-TI
lässt auch die Schriftart Arial zu, wobei dies mit Blick auf die
VwV-StVO eher als Ausnahme zu Gunsten der verfügbaren Technik zu
verstehen ist. Eine exakte Wiedergabe der
Schriftzeichen nach DIN 1451 Teil 2 ist auf einer LED-Matrixanzeige nur
bei einer vergleichsweise hohen Auflösung und entsprechenden
Schriftgrößen möglich. Je kleiner die Schriftgröße umso mehr Abstriche sind in
der Umsetzung notwendig. Für die Nachahmung der Schriftzeichen
nach DIN 1451 Teil 2 ist deshalb eine Mischung aus verschiedenen
Schriftarten erforderlich. Vorgaben für eine
einheitliche Darstellung der einzelnen Buchstaben und Zahlen
auf einer LED-Matrixanzeige fehlen bislang.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Hinweis auf eine geplante
Arbeitsstelle in Schriftart Arial. Der Rotstich resultiert aus
der verwendeten RGB-Optik - in der Entfernung erscheint die
Schrift weiß.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die kleinste Schriftgröße beginnt
bei 7 Pixeln (Großbuchstaben), was der Rasterung der DIN 1451
entspricht (Höhe = 7E). Kleinbuchstaben haben hierbei eine Höhe
von 5 Pixeln. Zu empfehlen ist diese Variante allerdings nicht.
Als Mindestanforderung ist eine Höhe von 9 Pixeln erforderlich,
besser ist jedoch eine Höhe von 10 bzw. 11 Pixeln für
Großbuchstaben, wobei sich für Kleinbuchstaben eine Höhe von 7
Pixeln ergibt.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
|
Beim Abgleich mit der nach M-TI
zulässigen Schriftart Arial fallen die Unterschiede durchaus
auf, insbesondere was die Wiedergabe der Zahlen betrifft. Wir
wollen an dieser Stelle aber gar nicht im Detail darüber
philosophieren, ob irgendwo noch ein Pixel hinzugefügt oder
weggelassen werden muss, um der Verkehrsschrift nach DIN 1451
Teil 2 näher zu kommen, sondern typische Fehler beim Setzen der
Schrift besprechen, die auch bei konventionellen Verkehrszeichen
an der Tagesordnung sind.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Spationierung (Abstandsgestaltung)
Bestimmte
Buchstabenkombinationen erfordern ein sog. Unterschneiden, damit
die Schrift insgesamt harmonisch wirkt. Werden die
Einzelbuchstaben dagegen immer mit demselben Abstand gesetzt
(z.B. ein Pixel) entstehen optisch zu große Lücken. Die
Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Anforderung auf einer
LED-Matrix sind naturgemäß begrenzt, realisierbar ist sie aber
dennoch.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
Die Orte wurden in der linken
Bildhälfte jeweils mit einem festen Buchstaben-Abstand von 2
Pixeln gesetzt, wodurch ein deutlicher Zwischenraum zum nachfolgenden
Kleinbuchstaben entsteht. Dagegen wurde bei der rechts daneben
abgebildeten Variante eine Unterschneidung um 1 Pixel
vorgenommen, beim Ort Varrel beträgt der Abstand sogar 0 Pixel
zwischen V und a. Die Abstandsreduzierung ist aber
nicht nur bei bestimmten Großbuchstaben erforderlich, sondern
betrifft auch Kombinationen von Kleinbuchstaben:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Eine Unterschneidung zwischen
Kleinbuchstaben ist z.B. beim r notwendig, insbesondere
wenn ein t oder f folgt - letzteres betrifft z.B.
die Endung -dorf. Auch bei doppelten Buchstaben wie rr,
tt oder ff erfolgt eine Unterschneidung um das
optische Gleichgewicht zu verbessern. Eine grafisch sinnvolle
Unterschneidung ist oftmals aber nur möglich, wenn der reguläre
Zeichenabstand 2 Pixel beträgt. Auf Grund der oftmals
unzureichenden Anzeigenbreite beschränkt sich der Abstand in der
Praxis meist auf 1 Pixel, so dass eine weitere Reduzierung zum optischen Verschmelzen benachbarter Buchstaben führen würde.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Zeilenabstand / Buchstaben mit Unterlängen
Die DIN 1451 sieht einen Abstand zwischen
untereinander befindlichen Worten von 4E vor, bzw. einen Abstand
der Grundlinien von 11E. Die Einheit 1E entspricht dabei 1/7 der
Schriftgröße h und beträgt z.B. bei 105mm (7E) 15mm. Der
normierte Zeilenabstand von 11 E soll einerseits eine klare Trennung der
Zeilen bewirken, aber insbesondere verhindern, das Buchstaben
mit Unterlängen (g j p q y) in die Buchstaben der darunter
befindlichen Zeile hineinragen. Zwar sind Ortsnamen mit Umlauten
am Anfang eher ungewöhnlich, aber die Systematik der Norm
berücksichtigt auch diese Problematik:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
|
In der Grafik wurde die relevante
Schriftgröße (h = 7E) hellgrau unterlegt. Die Unterlänge der
Kleinbuchstaben beträgt 2E, die untereinander liegenden Zeilen
sind Gelb dargestellt. Würde der Abstand zwischen untereinander
befindlichen Wörtern nur 3E betragen, könnte es zu einer
Kollision zwischen dem Ä und der Unterlänge des p
von Apolda kommen. Dies wird in der Norm durch den Abstand von
insgesamt 4E verhindert.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Werden Ortsbezeichnungen bzw. Texte
ohne Unterlängen gesetzt, kann der Abstand untereinander
durchaus auf 3E (entspricht 10E Zeilenabstand) reduziert werden,
was z.B. bei einigen Zusatzzeichen gemäß VzKat historisch
bedingt auch der Fall ist. Eine pauschale Reduzierung auf 3E ist
jedoch unzweckmäßig und entspricht nicht der DIN 1451 Teil 2.
Diesbezügliche Vorgaben neuerer Regelwerke (z.B. Merkblatt für
den Einsatz von temporärer Umleitungsbeschilderung M-TU 2022
oder Richtlinien für die wegweisende Beschilderung auf
Autobahnen - RWBA 2023) sind deshalb eher fragwürdig. Nicht
wegen dem recht unwahrscheinlichen Fall, dass ein kleines g, j,
p, q oder y mit einem darunter befindlichen Ä, Ö oder Ü
kollidieren könnte, sondern weil u.a. Kleinbuchstaben mit Unterlängen
künftig in weiße und gelbe Farbeinsätze hineinragen. Aber dieses
Kuriosum wollen wir an dieser Stelle nicht weiter vertiefen.
Zumindest bleibt zu hoffen, dass die diesbezüglichen "Lösungen"
aus der Praxis nicht bundesweit als notwendige Anpassung der RWBA 2023
umgesetzt werden:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
Beispiele aus Hessen: Buchstaben mit
Unterlängen (Miquellallee, Würzburg) werden einfach abgeschnitten oder in der Höhe
verkleinert, um die Problematik auf Prismenwendern und Schildern
mit weißen und gelben Farbeinsätzen zu "heilen". Bastelkram wie
dieser entspricht natürlich nicht der DIN 1451 Teil 2.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 |
 |
 |
|
LED-Buchstaben mit Unterlänge
bei zu geringem Zeilenabstand |
fragwürdige Verkleinerung der betroffenen
Buchstaben nach dem oben gezeigten Vorbild |
korrekte Umsetzung mit einem
Abstand von 5 Pixeln |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
Beispiele aus der Praxis mit
unzulässig verkleinerten Buchstaben p und g, die keine Unterlänge aufweisen sondern an der Grundlinie enden.
Durchaus erkennbar aber als Lösung für den Straßenverkehr eher
fragwürdig - zumal der erforderliche Platz in beiden Fällen
vorhanden ist. Auffällig ist auch die fehlende Unterschneidung
zwischen den beiden r von Sperrung sowie die
unterschiedliche Ausführung der Zahl 4.
Das linke der nachfolgenden
Beispiele ziert sogar das Deckblatt der Hinweise für die
Absicherung von Markierungsarbeiten (HAM 23):
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|
|
Auf Wechselverkehrszeichen an
Straßenmarkierungsmaschinen ist das
verkleinerte g ebenfalls anzutreffen und sozusagen
Branchenstandard |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die Variante der teilamputierten
Kleinbuchstaben ist weder auf konventionellen Wegweisern und
Verkehrszeichen zulässig, noch taugt sie als Vorlage für die
Umsetzung auf LED-Vorwarnanzeigern oder teilstationären
LED-Wechselverkehrszeichen. Stattdessen ist auch in diesem
Zusammenhang eine sorgfältige Planung erforderlich, welche die
Grenzen der heute verfügbaren Anlagen sachgerecht
berücksichtigt. Die Notwendigkeit zur Entwicklung modularer
Systeme für variable Anzeigegrößen wurde in diesem Beitrag
bereits mehrfach thematisiert - sie wäre auch der
ordnungsgemäßen Darstellung von Zielangaben oder Texten
dienlich.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|
LED-Tafel aus der Praxis |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die gezeigte Tafel wurde aus
urheberrechtlichen Gründen nachgebildet, entspricht aber
ansonsten exakt der Darstellung vor Ort. Obwohl es sich mit 64 x
96 Pixeln um eine der größeren standardisierten Anzeigeflächen
handelt, können die Inhalte nicht vollständig abgebildet werden.
Zunächst stellt sich wie bei konventionellen Hinweistafeln aus
Blech die Frage, warum zusätzlich zur Abbildung von Zeichen 250
der Hinweis "Vollsperrung" erforderlich ist. Jedenfalls sorgt
dessen Abbildung zusammen mit den beiden Verkehrszeichen dafür,
dass bei dem Wort "zwischen" nicht nur der i-Punkt, sondern auch
ein Teil des h einfach wegrationalisiert wurde.
Interessant ist auch das kleine b,
welches unnötigerweise einen Pixel höher ist als vergleichbare
Kleinbuchstaben. Die Gestaltung des B von Bruchsal, des
U vom Ubstadt und des Kleinbuchstaben a lassen
vermuten, dass die Einzelzeichen entweder per hand Pixel für
Pixel gezeichnet wurden, oder das die verwendete Schriftart
etwas merkwürdig skaliert ist. Dazu passend ist das Datum
kleiner als der Rest der Schrift und die 0 hat einen Querstrich,
der weder in der DIN 1451 Teil 2 noch bei der Schriftart Arial
vorgesehen ist.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Einheitliche Schriftgröße auf der gesamten
Tafel
Bei der Gestaltung von konventionellen
Infotafeln, temporären Wegweisern oder Zielangaben über
Umleitungsschildern wird oft nach folgendem Prinzip verfahren:
Ist der Text oder das Ziel kurz wie beispielsweise Ulm, Köln
oder Jena, wird eine
große Schriftgröße verwendet. Sind dagegen breite Texte oder
Ziele erforderlich, wird die Schrift entweder bei gleicher
Schriftgröße unzulässig zusammengequetscht, oder eben
proportional kleiner ausgeführt. Und was sich bei Blechschildern
vermeintlich bewährt hat und durch die Behörden nicht beanstandet wurde,
setzt man heutzutage natürlich mit LED-Tafeln um:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|
LED-Tafel aus der Praxis |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Textlicher Hinweis auf eine Sperrung
mit drei verschiedenen Schriftgrößen: B 14 und
Stuttgart haben eine Höhe von 11 Pixel, Richtung und
gesperrt 10 Pixel und das Datum ist 8 Pixel hoch. Dabei
ist die Tafel groß genug, um alle fünf Zeilen mit einer
einheitlichen Schriftgröße von beispielsweise 10 Pixeln
auszuführen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Falsche Skalierung durch die Software
Die unbedarfte Skalierung von
Schriften in der jeweils verwendeten Software führt oft zu
Abweichungen bei der Darstellung von einzelnen Buchstaben oder
Zahlen. Da die meisten LED-Wechselverkehrszeichen keine
interpolierte Wiedergabe zulassen (was bei der üblichen
Auflösung auch nicht wirklich notwendig ist und sogar
kontraproduktiv sein kann), ist ein LED-Pixel
entweder an oder aus. Der Binärcode 1 und 0 führt dazu, dass die Strichstärken der Zeichen variieren oder das an
eine Rundung ein Pixel gesetzt wird, der dort eigentlich nicht
hingehört:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|
|
falsch
skalierte Schrift auf einer LED-Matrix |
korrekte Ausführung mit einheitlicher Systematik |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die linke Abbildung verdeutlicht was
passiert wenn eine Schrift in einer Rastergrafik nachträglich skaliert wird:
Buchstaben und Zahlen werden scheinbar "willkürlich" verändert
und unterscheiden sich, obwohl sie eigentlich identisch sind.
Die erste 1 fällt ein Pixel kleiner aus als die andere
und der zweite Punkt des Datums hat durch die Skalierung einen
zusätzlichen Pixel erhalten. Beim Schriftzug gesperrt
wurden das g und das zweite e abgeschnitten und
die beiden r weisen eine unterschiedliche Strichstärke
auf. Insgesamt wirkt das linke Ergebnis wenig professionell und
entspricht selbst als Pixelschrift weder der DIN 1451 Teil 2
noch der Schriftart Arial.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Umsetzung der RSA 21 bei LED-Vorwarnanzeigern
Umsetzung der RSA 21 bei LED-Vorwarnanzeigern
Die RSA 21 wurden im Februar 2022 bekannt gegeben, doch deren
Umsetzung erfolgt erwartungsgemäß eher zögerlich und bleibt in
einigen Regionen ganz aus. Insbesondere die in den Autobahn-Regelplänen
(Teil D)
vorgesehene Längenangabe unter Zeichen 274 auf Vorwarnanzeigern
findet bislang nur sporadisch Anwendung. Stattdessen werden die
vorhandenen Anlagen mit den bis dato verfügbaren Bibliotheken
einfach weiter betrieben als wäre nichts gewesen. Selbst die
eilig von den Herstellern vorgestellte "Kompromiss-Lösung" zur
Anzeige der Längenangabe im unteren Teil der Obertafel bzw. im
oberen Teil der Untertafel ist in der Praxis bislang nur selten anzutreffen.
Dabei sollte man meinen, dass
zumindest die Autobahn-GmbH
diesbezüglich für eine einheitliche Verfahrensweise in ihrem
Zuständigkeitsbereich sorgen könnte - doch Fehlanzeige. Auf
unseren Autobahnen ist ein buntes Konglomerat aus den
technischen Entwicklungsständen der vergangenen drei Jahrzehnte
im Einsatz und so findet der Verkehrsteilnehmer an identischen
Arbeitsstellen eine unterschiedliche Beschilderung vor -
teilweise auf ein und derselben Autobahn und nur wenige Kilometer
voneinander entfernt.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Längenangabe unter Zeichen 274
Längenangabe unter Zeichen 274
Über Jahrzehnte hinweg wurden Arbeitsstellen
kürzerer Dauer auf Autobahnen falsch beschildert, da im
Zulaufbereich ein Tempolimit angeordnet wurde, ohne dass hierfür eine
entsprechende Aufhebung vorgesehen war. Zwar ist
Otto-Normalverkehrsteilnehmer durchaus in der Lage, das Ende der
arbeitsstellenbedingten Geschwindigkeitsbeschränkung zu
erkennen, doch rein formell besteht eine automatische Aufhebung
i.S.d. StVO eben nur dann, wenn das Zeichen 274 zusammen mit einem
Gefahrzeichen angeordnet wird. Das war aber in den entsprechenden
Regelplänen der RSA 95 nicht vorgesehen.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Typische und auch heute noch übliche Beschilderung einer
Arbeitsstelle kürzerer Dauer: LED-Vorwarnanzeiger mit Zeichen
274-60 ohne explizite Aufhebung. |
|
|
| |
|
|
| |
|
Blinkende Schilder als vermeintliche Lösung
In der Praxis versuchte man die genannte
Problematik dahingehend zu lösen, indem man auf
LED-Vorwarnanzeigern abwechselnd die Zeichen 123 und 274 zeigte,
um hierdurch die StVO-Anforderung "zusammen mit Gefahrzeichen"
zu erfüllen. Andere "Lösungen" bestanden in der gleichzeitigen
Anzeige des Textes "Baustelle" unterhalb der
Fahrstreifen-Darstellung, was bereits deshalb fragwürdig ist,
weil ein Text kein Gefahrzeichen ist und es zudem
"Arbeitsstelle" heißt (folglich heißt die Baustellenausfahrt
auch Arbeitsstellenausfahrt, aber das ist ein anderes Thema).
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Der Zusatz "Baustelle" ist weder
erforderlich noch vorgesehen und hat zudem nicht dieselbe
Wirkung wie das Gefahrzeichen 123. |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|
Längenangabe unter Zeichen 274 gemäß RSA 21 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die Darstellung in den RSA 21
enthält als Längenangabe das Zeichen 1001-30 in derselben Breite
wie die darunter befindliche Fahrstreifen- oder Verkehrslenkungstafel. Bereits das
ist falsch, da sich das Zusatzzeichen auf das Zeichen 274
bezieht und folglich dessen Breite (750 mm gemäß VzKat) entsprechen muss.
Allerdings sind beide Varianten mit konventionellen
Vorwarnanzeigern nicht darstellbar, so dass zwischenzeitlich folgende Kompromisse
entwickelt wurden:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
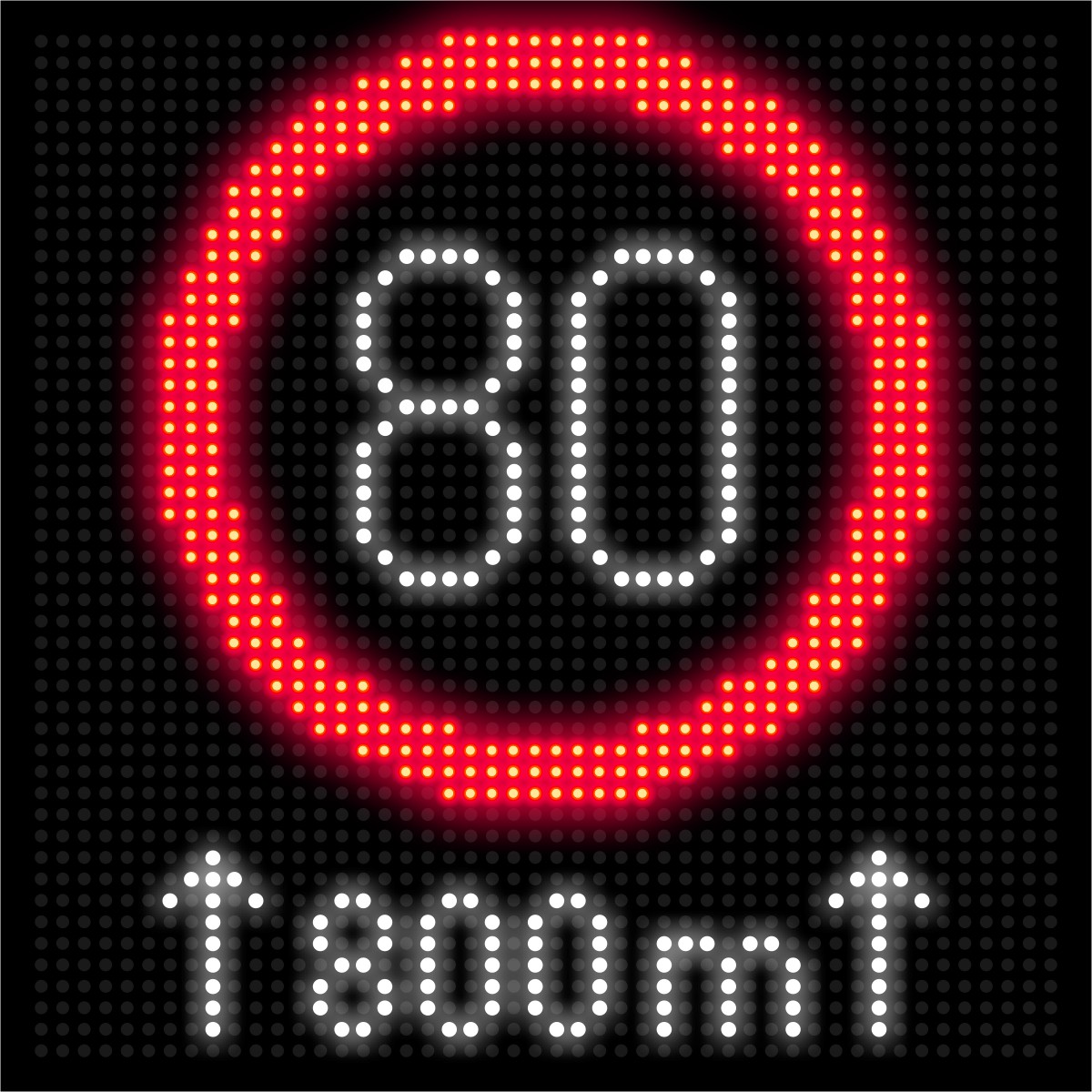 |
 |
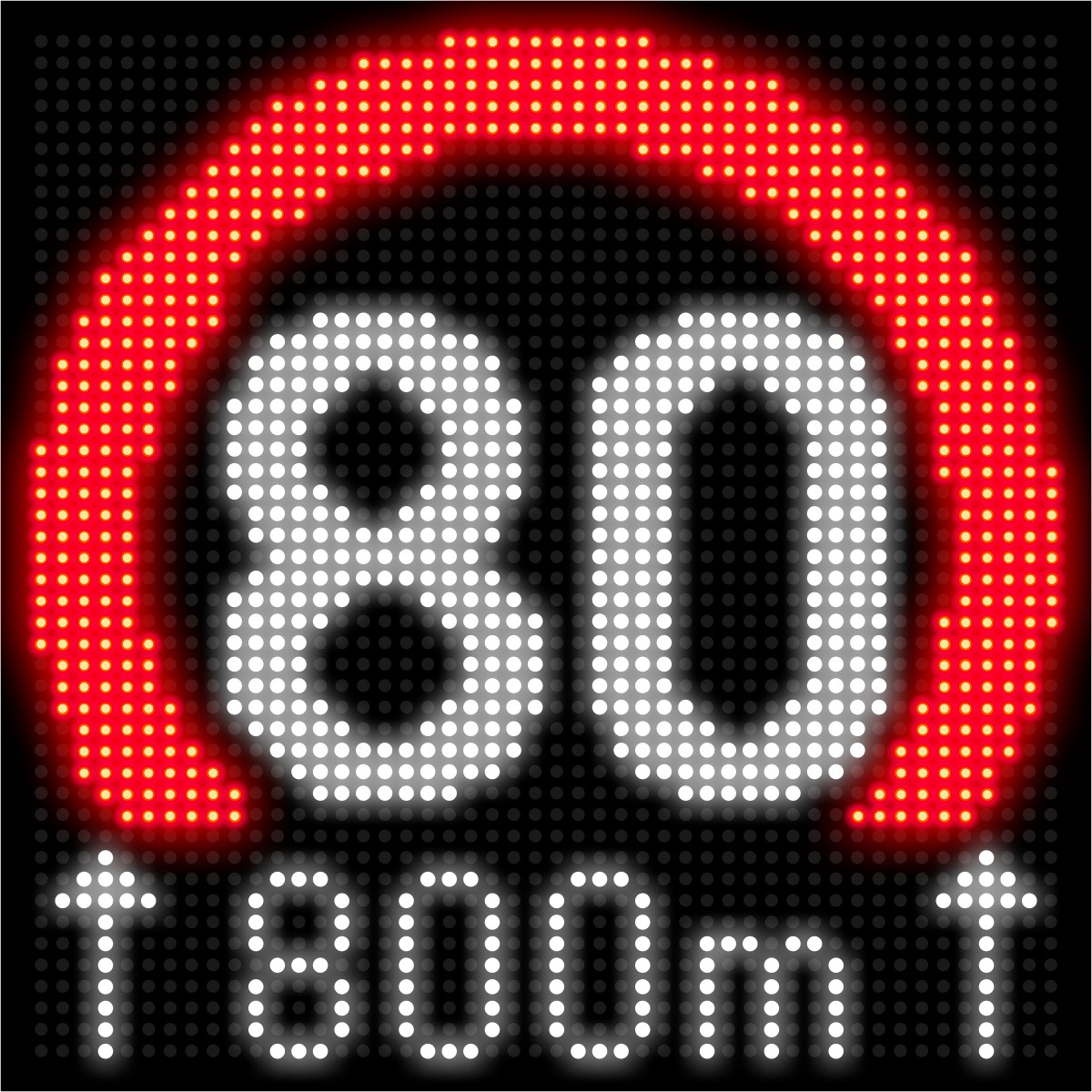 |
|
|
|
Längenangabe auf
Anzeige mit 48 x 48 Pixel |
Variante eines
Herstellers |
Variante aus der Praxis
(bislang leider ohne Foto) |
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Darstellung mit Längenangabe auf der Untertafel. Anlagen mit großer einteiliger
Anzeigefläche können die Inhalte deutlich besser anzeigen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Seitenstreifen befahren
Seitenstreifen befahren
Ebenfalls seit Jahrzehnten
ist die temporäre Seitenstreifenfreigabe an Arbeitsstellen
kürzerer Dauer in der Praxis etabliert. Die notwendige
Rechtsgrundlage fehlt allerdings bis heute, denn eine "echte" Freigabe des
Seitenstreifens, bei welcher die Fahrbahnbegrenzung wie eine
Leitlinie überfahren werden darf (vgl. Anlage 2 lfd. Nr. 68 StVO zu
Zeichen 295), ist in der StVO nur durch
die Zeichen 223 vorgesehen:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Seitenstreifenfreigabe mittels
ortsfester Verkehrsbeeinflussungsanlage. Nur die Zeichen 223
erwirken die entsprechende Verhaltensvorschrift nach StVO.
Anmerkung: Die Pfeilspitzen entsprechen in dieser Form natürlich
nicht dem Herzpfeil nach StVO bzw. VzKat.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Im Anwendungsbereich der RSA 21 wird
die temporäre Seitenstreifenfreigabe lediglich mittels
Verkehrslenkungstafel (z.B. Zeichen 511-25) angezeigt. Die Zulässigkeit des
Überfahrens der Fahrbahnbegrenzung wird dadurch ebenso wenig
geregelt, wie das Zurückfahren über dieselbe Linie, die nunmehr
für den auf dem Seitenstreifen fahrenden Verkehr eine
durchgehende Fahrstreifenbegrenzung wäre. Genau genommen fehlt
es auch an einer Verpflichtung den Seitenstreifen im Anschluss
an die Arbeitsstelle zu räumen -
all dies ist im "amtlichen" System der Zeichen 223
berücksichtigt.
Vermutlich in Kenntnis dieser ganzen Ungereimtheiten hat man den
Vorwarnanzeigern in den entsprechenden RSA-Regelplänen nunmehr das
Zusatzzeichen 1013-50 spendiert, obwohl es eigentlich zu Zeichen 223.1
gehört:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
|
|
|
Zusatzzeichen 1013-50 als Bestandteil
eines Vorwarnanzeigers gemäß RSA 21 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die Macher der RSA 21 haben hierfür
die Abbildung des Vorwarnanzeigers kurzerhand in der Höhe
verlängert, um das bislang nicht vorgesehene Zusatzzeichen
1013-50 zu ergänzen und damit nach eigenem Bekunden den oben
erwähnten "Entwicklungsimpuls" gesetzt, welcher letztendlich zur
Herstellung von Vorwarnanzeigern mit großer einteiliger
Anzeigefläche geführt hat. Alle diesbezüglichen neuen Anlagen
sind aber genau genommen weiterhin zu klein, denn die RSA-Variante
benötigt bereits zur Kombination der einzelnen Blechschilder
eine Höhe von etwa 3,30m, was einer Anzeigefläche von etwa 165 x
64 Pixel entspricht (20mm Raster). Und in diesem Fall reden wir noch nicht von der Festlegung des M-TI zur
Darstellung von Ronden mit 1000 mm Durchmesser:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
Kombination der Einzel-Schilder,
Zeichen 274 und 1001-30 in Größe 3 |
Zeichen
274 mit Ø 1000 mm gemäß M-Ti,
Zeichen 1001-30 gemäß RSA 21 |
Zusatzzeichen mit einer Höhe von 500 mm
für den Einsatz mit Verkehrslenkungstafeln |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Das kuriose Maß von 444,44 mm für das
Zusatzzeichen 1013-50 resultiert aus dessen tatsächlicher Größe
von 800 x 2250 mm, da es eigentlich zur Verwendung mit Zeichen
223 vorgesehen ist und in den RSA 21 lediglich auf die übliche
Breite von Verkehrslenkungstafeln (1250 mm) verkleinert wurde.
Ähnlich verhält es sich bei der breiten Längenangabe unter
Zeichen 274, denn das Zeichen hat in den RSA-Regelplänen eine
Höhe von 385 mm. Das Zeichen 1001-30 wäre in Größe 3 dagegen
415mm hoch und 750mm breit, oder hätte als Zusatzzeichen zu
einer Verkehrslenkungstafel sogar eine Höhe von 500 mm. Die 100
mm Abstand im oberen Teil der Kombination ergeben sich aus der
VwV-StVO für Schilder, die in keinem direkten Bezug zueinander
stehen. Eine Regelung die in der Praxis nur selten beachtet wird.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Alle drei Varianten verdeutlichen
den Interpretationsspielraum, der bei der Umsetzung des Inhaltes
auf einer LED-Anzeigefläche gegeben ist. Folglich bedarf es
einheitlicher Vorgaben, welche die unterschiedlichen
Anforderungen von VzKat, M-TI und RSA 21 sinnvoll
vereinheitlichen und so als Grundlage für alle künftigen
Entwicklungen dienen. Ob man in diesem Kontext das Zusatzzeichen
"Seitenstreifen befahren" wirklich abbilden muss, ist jedenfalls
diskussionswürdig. Im Bereich der Anzeigetechnik sind wie
beschrieben Verbesserungen geboten (Auflösung), bezüglich der
erforderlichen Tafelgröße ist allerdings auch immer die maximal
zulässige Höhe eines Fahrzeugs (4 m) zu beachten.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Der Seitenstreifen ist keine Standspur
In diesem Zusammenhang muss klar sein, dass sich die Abbildung
des Wortes "Seitenstreifen" auf einer Tafel mit einer
Auflösung von
48 Pixeln in der Breite zwar irgendwie darstellen lässt, wobei das Ergebnis allerdings
nicht als ideal zu bezeichnen ist. Die Hersteller haben dafür
natürlich schon lange eine Lösung, die aus der Praxis auch nicht
wegzudenken ist: Aus dem verkehrsrechtlich relevanten
Fachbegriff "Seitenstreifen" wird ganz einfach die
umgangssprachliche "Standspur", welche nur 9 anstatt 14
Buchstaben benötigt. Auch in diesem Fall gilt: Wenn das
Zusatzzeichen 1013-50 gemäß RSA-Regelplan angeordnet wird, dann heißt es
"Seitenstreifen" und nicht "Standspur". Eine grafisch sinnvolle Darstellung des
korrekten Begriffs ist dabei üblicherweise erst ab 60 Pixel
Anzeigenbreite möglich:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|
|
Darstellung auf 64 Pixel breiter Anzeigefläche |
bisherige Lösung der Hersteller (48 Pixel) |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Die Sache mit dem umlaufenden Rand
Die Sache mit dem umlaufenden Rand
Der Autor wurde bereits vor vielen Jahren von
einem Hersteller gefragt, ob denn die Abbildung des
Randes von Fahrstreifen- bzw. Verkehrslenkungstafeln
verkehrsrechtlich zwingend notwendig ist. Die Antwort auf diese
Frage lautet natürlich "ja", allerdings kann man diesbezüglich
durchaus die Kirche im Dorf lassen, denn LED-Verkehrszeichen
verfügen auch ohne invertierte Wiedergabe des schwarzen Randes
über eine sehr gute Erkennbarkeit. Bei der damaligen Anfrage
ging es zudem nur um die Darstellung von Fahrstreifen,
welche zu dieser Zeit noch überwiegend in der Farbe Gelb
erfolgte und daher so oder so einen Kompromiss darstellte.
Mit den Änderungen der RSA 21 werden
allerdings nicht nur bloße Fahrstreifendarstellungen angezeigt,
sondern - je nach Regelplan - gleich zwei Zusatzzeichen: Zeichen
1001-30 unter Zeichen 274 und das eben besprochene Zeichen
1013-50 als Zusatz zur grafisch dargestellten
Seitenstreifenfreigabe. Entsprechend stellt sich die Frage nach dem
Rand erneut und wieder lautet die Antwort stur nach StVO:
Natürlich mit Rand.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|
|
Zeichen
1001-30 mit umlaufendem Rand |
Zeichen 1013-50 mit umlaufendem Rand |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Insbesondere beim umrandeten Zeichen
1013-50 zeigt sich der
Vorteil von Anlagen mit einer 64-Pixel-Anzeigefläche, denn nur
dadurch wird die Darstellung gemäß RSA 21 erst möglich. Auf
Vorwarnanzeigern mit lediglich 48-Pixel-Anzeigefläche ist die
Wiedergabe des Zeichens mit Rand nicht möglich, es sei denn man
begnügt sich damit, dass der ein oder andere Buchstabe zur
Hieroglyphe mutiert.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Die Abbildung des umlaufenden Randes
ist aus verkehrsrechtlichen Gründen insbesondere bei
Zusatzzeichen erforderlich, sie kann aber kontraproduktiv
wirken, wenn der Abstand zum Sinnbild oder einem Text auf Grund
der beengten Anzeigefläche zu gering ausfällt. Im gezeigten
Beispiel entspricht das Ergebnis eher einem "LKW" im Kasten als
dem Zusatzzeichen 1010-51. Zudem ist in größerer Entfernung
zunächst nur ein Rechteck sichtbar, welches die Erkennbarkeit
des "LKW"-Sinnbildes erschwert.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Darstellung gemäß RSA 21 - bislang nur mit
Kompromissen möglich
Die Wiedergabe des weißen
Randes umfasst gemäß der Abbildung in den Regelplänen natürlich
auch die Fahrstreifen- und Verkehrslenkungstafeln. In diesem
Zusammenhang sei noch einmal auf die erwähnte "schlanke"
Pfeildarstellung verwiesen, denn der Rand kostet wertvolle Pixel. Entsprechend bieten auch in diesem Fall
LED-Vorwarnanzeiger mit 64-Pixel-Anzeigefläche Vorteile, vor allem wenn mehr als drei Fahrstreifen angezeigt
werden müssen. Trotzdem sind auch bei der Verwendung der
aktuellen LED-Vorwarnanzeiger mit einteiliger Anzeigefläche
Kompromisse nötig, wenn das Zusatzzeichen 1013-50 abgebildet
werden muss:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|
|
Darstellung auf Anzeigefläche
mit 64 x 144 Pixel (Kompromiss) |
Darstellung
mit umlaufendem
Rand (64 x 168 Pixel) |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Letztendlich stellt sich bei dieser
ganzen Pixel-Bastelei die Frage, wie sinnvoll die Wiedergabe des
weißen Randes tatsächlich ist. Die Praktiker werden die
Notwendigkeit selbstverständlich verneinen und der Autor sieht
das im Grunde genauso. StVO-Puristen werden wiederum auf die
Abbildung des Randes bestehen und das zu Recht, denn genau so
ist die Darstellung in den Regelplänen der RSA 21 enthalten.
Da eine Änderung der StVO zu Gunsten
einer vereinfachten Darstellung ohne weißen Rand nicht zu
erwarten ist, besteht die Lösung im Grunde nur darin, dass
endlich eine entsprechende Regelung zur Seitenstreifenfreigabe
via Verkehrslenkungstafel in die StVO aufgenommen wird, so dass
in der Konsequenz das Zusatzzeichen
1013-50 entfallen kann. Eine derartige Festlegung, die auch das
anschließende Wiedereinordnen auf die regulären Fahrstreifen umfasst, ist
mithin auch verkehrsrechtlich längst überfällig.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Warnleuchten an Vorwarnanzeigern
Warnleuchten an Vorwarnanzeigern
Im Zuge der Überarbeitung der
Technischen Liefer- und Prüfbedingungen für Warnleuchten (TLP-Warnleuchten) ergab sich im
damit befassten Arbeitskreis die Diskussion
bezüglich der Leuchten im oberen Teil von Vorwarnanzeigern.
Während das Merkblatt für Tafeln mit lichttechnischem
Informationsteil (M-TI) eine Zweifach-Warnanlage vom Typ WL 5
(Blitzlicht) benennt, sehen die RSA 21 blinkende Warnleuchten
vor, welche dem Typ WL 7 gemäß TL-Warnleuchten entsprechen.
Allerdings enthält auch das M-TI in der Beschreibung der
Technischen Ausführung (5.2) die Begriffe "Vorwarnblinker" und
"Blinker synchron", was sicherlich auf die
umgangssprachliche Wortwahl in der Verkehrssicherungsbranche
zurückzuführen ist.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|
|
Warnleuchten vom Typ WL 5 (Blitzlicht) |
Warnleuchten vom Typ WL 7 (Blinklicht) |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die Befürworter der blitzenden
Leuchten vom Typ WL 5 begründeten deren Einsatz maßgeblich
damit, dass Warnleuchten vom Typ WL 7 auf Grund der hohen
Lichtstärke die Erkennbarkeit der LED-Anzeigefläche erschweren
würden. Dagegen sei der kurze Blitzimpuls der WL 5 mit einer
geringeren Lichtstärke besser geeignet, um die Lesbarkeit der
LED-Tafel zu gewährleisten.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
In der Praxis ist der beschriebene
"Blendeffekt" nicht festzustellen. Der überwiegende Teil der
eingesetzten LED-Vorwarnanzeiger und LED-Stauwarnanlagen
arbeitet mit blinkenden LED-Leuchten vom Typ WL 7, welche eine sehr
intensive Warnung über weite Distanzen erwirken, was der
Erkennbarkeit der Anzeigefläche in der relevanten
Lesbarkeitsentfernung trotzdem nicht entgegensteht. Selbst auf
dem rechten Fahrstreifen hat der Fahrzeugführer den engen
Lichtkegel der Warnleuchten von lediglich 3° bereits verlassen, wenn er in den
gemäß M-TI definierten Nahbereich eines Vorwarnanzeigers gelangt:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
LED-Vorwarnanzeiger mit blinkenden
LED-Warnleuchten vom Typ WL 7 und gleichzeitiger Erkennbarkeit
der Anzeigefläche.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Angesichts des Unfallgeschehens im
Bereich von Arbeitsstellen kürzerer Dauer bedarf es jedenfalls
einer rechtzeitigen und intensiven Vorwarnung, welche nur durch
blinkende Leuchten des Typs WL 7 erzielt werden kann. Unabhängig
vom angezeigten Inhalt der LED-Vorwarnanzeiger ist die Arbeitsstelle
im Idealfall schon über mehrere Kilometer sichtbar und darauf
kommt es in erster Linie an.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Unfälle mit LED-Vorwarnanzeigern
sind keine Seltenheit. Insbesondere an beweglichen
Arbeitsstellen sind dabei oft Schwerverletzte oder Tote zu
beklagen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die Wahl der Warnleuchten kann
solche Ereignisse natürlich nicht verhindern, dass zeigen
vergleichbare Unfälle mit fahrbaren Absperrtafeln, bei denen der
blinkende Pfeil oder das Leuchtkreuz bereits über weite
Distanzen deutlich sichtbar ist - ergänzt durch die
300mm-Blitzleuchten der Obertafel. Es ist allerdings auch
erwiesen, dass blitzendes Licht - allein - deutlich schlechter
sichtbar ist, weshalb bereits in den RSA 95 vornehmlich
blinkende Warnleuchten gefordert wurden (Vorwarnleuchten vor
Überleitungen, Aufbaulicht-Anlagen anstelle von Lauflicht in
Elektronenblitz-Technik usw.). Blitzende Leuchten vom Typ WL 5
sind daher nur in Kombination mit blinkenden Warnleuchten (WL 6)
einzusetzen, z.B. bei Leuchtpfeil-Kombinationen. Als alleinige
Warnung sind sie dagegen oft unzureichend.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Stromersparnis
Die Festlegung zu Warnleuchten vom Typ WL 5 stammt ursprünglich
aus einer Zeit, in der LED-Vorwarnanzeiger noch mit
Halogen-Vorwarnleuchten vom Typ WL 7 bestückt waren, welche den
Akku zusätzlich zum nicht unerheblichen Energiebedarf der LED-Anzeigefläche
beanspruchten. Je nach dargestellter Verkehrsführung und den
Umgebungsbedingungen reichte
eine Akku-Ladung nicht für einen Arbeitstag aus. Blitzende
Warnleuchten vom Typ WL 5 (damals noch als
Xenon-Elektronenblitz) hatten dagegen eine geringere
Stromaufnahme und letztendlich ist das wohl auch der Hauptgrund für
die Wahl dieser Leuchten.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Mit Einführung der heute
üblichen LED-Vorwarnleuchten stellt sich die Frage nach der
Stromaufnahme kaum noch, da auch die blinkenden Anlagen vom Typ WL 7 sehr sparsam sind (herstellerabhängig). Einsparpotential
bezüglich der Stromaufnahme besteht maßgeblich in der
Anzeigefläche selbst, z.B. wenn das Zeichen 274 nicht in Übergröße
mit überdimensioniertem roten Rand
und dem Schriftstil "fett" dargestellt wird, sondern so wie es
nach StVO und VzKat ausreichend ist. Auch bei der Wiedergabe der
Pfeile besteht die Möglichkeit zur Reduzierung der
Stromaufnahme bei gleich bleibender Erkennbarkeit, denn der
Pfeilschaft muss auf Grund der lichttechnisch bedingten Überstrahlung
(Äquivalentfläche) nicht 4 oder 5 Pixel breit
sein (bei 20mm Raster).
|
|
|
| |
|
|
| |
|
 Sind Warnleuchten als Bestandteil der
LED-Matrix zulässig?
Sind Warnleuchten als Bestandteil der
LED-Matrix zulässig?
Wie beschrieben war es ein
Dienstleistungsunternehmen für Verkehrssicherung, welches als
erstes den "Entwicklungsimpuls" der RSA 21 umsetzte und einen
Vorwarnanzeiger mit einteiliger Anzeigefläche vorstellte. Das System verfügt im Vergleich zu den später
entwickelten Anlagen der bekannten Hersteller über keine
separaten TL-Warnleuchten vom Typ WL 7, sondern erzeugt das erforderliche
Blinklicht mit der ohnehin vorhandenen LED-Matrix.
Doch ist diese Art der Darstellung
zulässig? Der Jurist würde mit einem glasklaren "Kommt drauf an"
antworten.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|
|
Warnleuchten als Bestandteil der LED-Matrix |
Abbildung gemäß RSA 21, Bild A-10 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Die RSA 21
sehen exakt diese Art der Umsetzung in Bild A-10 (Teil A
3.5.2) vor, allerdings wohl auch nur deshalb, weil man die
Darstellung aus den ursprünglichen Entwürfen zur Änderung der
Teile A und D aus dem Jahr 2005 über die 20-jährige
Bearbeitungszeit der RSA "mitgeschleppt" hat, ohne für eine zeitgemäße
und vor allem praxisgerechte Abbildung mit separaten
Vorwarnleuchten zu sorgen. Grafische Vorlagen hierzu finden sich
u.a. in den RSA-eigenen Regelplänen, im Merkblatt für Tafeln mit
lichttechnischem Informationsteil (M-TI) und natürlich in Form
der bisherigen Anlagen aus der Praxis.
Jedenfalls ist
diesbezüglich festzuhalten, dass die LED-Tafel des
Dienstleistungsunternehmens im Grunde als bislang einziges
System wirklich der Abbildung A-10 gemäß RSA 21 entspricht. Ob
das tatsächlich der Anspruch nach RSA 21 ist, steht natürlich
auf einem anderen Blatt. Im Sinne der bisher üblichen Anlagen
wären jedenfalls separate TL-Warnleuchten neben oder über der
LED-Anzeigefläche erforderlich, insbesondere weil nur Leuchten
vom Typ WL 7 die erforderliche Warnwirkung über große Distanzen
sicherstellen.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Bedeutung der technischen Lieferbedingungen
Vor allem stellt sich in dieser Sache inzwischen die Frage, welchen Wert die
technischen Lieferbedingungen (in diesem Fall für Warnleuchten) heutzutage überhaupt noch haben.
Mit der Aufgabe der Produktprüfungen durch die BASt (vgl. ARS Nr.
23/2022) entfällt künftig auch das weltweit anerkannte
Qualitätsmerkmal "BASt-geprüft", mit welchem man als Hersteller
seine Produkte oft problemlos auf dem internationalen Markt
etablieren konnte. Zwar wird im entsprechenden ARS inhaltlich nur von einer
Liberalisierung des Marktes zu Gunsten anderer akkreditierter
Prüfinstitute gesprochen, gleichzeitig stellte die BASt aber
ihre Prüftätigkeit für TL-Warnleuchten, TL-Leitbaken und
TL-Leitkegel vollständig ein.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LED-Warnleuchten vom Typ WL 7 die noch durch die BASt geprüft
und "zugelassen" wurden. |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
In der Folge fehlt es künftig an der bisher
üblichen - neutralen - technischen Bewertung und Produktfreigabe durch eine
Bundesstelle (vergleichbar mit dem Eisenbahn-Bundesamt oder dem
Kraftfahrt-Bundesamt), so dass die Anwender vermehrt mit
fragwürdigen Produkten aus dem Ausland konfrontiert werden
dürften, die schon jetzt den Markt erobern. Deren künftige "TL-Zulassung" muss dabei nicht
wie eigentlich vorgesehen durch akkreditierte
Prüfinstitute erfolgen, sondern man kann die jeweiligen
Prüfberichte im Ausland für vergleichsweise geringe Kosten
einfach kaufen, ohne dass die Warnleuchte jemals ein Prüflabor von
innen gesehen hat (!)
Wenn künftige
LED-Vorwarnanzeiger oder fahrbare Absperrtafeln mit
"TL-Warnleuchten" des Herstellers "Ling-Wan-Jong
Co. Ltd."
ausgestattet werden, bleibt insbesondere den öffentlichen
Beschaffern nichts anderes übrig, als das am selben Tag der
Nachfrage ausgestellte "Prüfzeugnis" zähneknirschend zu
akzeptieren. Vor diesem Hintergrund relativiert sich die Frage
nach der Zulässigkeit von per LED-Matrix erzeugten Warnleuchten
doch recht schnell, denn die bislang etablierten vergleichsweise
hohen Standards werden - unter dem Deckmantel der
Liberalisierung - an anderer Stelle immer weiter aufgeweicht.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Zeichen 101 ist als bloße Ankündigung nicht zulässig
Zeichen 101 ist als bloße Ankündigung nicht zulässig
Zum Abschluss dieses Beitrags darf der Hinweis zur
Unzulässigkeit von Zeichen 101 natürlich nicht fehlen, denn auch
auf LED-Vorwarnanzeigern und Verkehrsbeeinflussungsanlagen ist
die sachfremde Verwendung dieses Gefahrzeichens weiterhin
üblich:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Achtung! A 71 Schweinfurt gesperrt
via U 40 - so der fehlgeleitete Gedanke hinter dieser
Ankündigung. |
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Achtung! Auf der A 4 gibt es ab
25.04.2022 Bauarbeiten, richten Sie sich dann auf
Behinderungen ein. (Aufnahme vom 23.04.2022) |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Zeichen 101 bedeutet nicht "Achtung"
sondern "Gefahrstelle"
Zeichen 101 bedeutet nicht "Achtung"
sondern "Gefahrstelle"
Bundesweit besteht in vielen
Behörden, Ingenieurbüros und Verkehrssicherungsunternehmen ein
fragwürdiges Verständnis zur Bedeutung von Zeichen 101. Das
Zeichen ist ein Gefahrzeichen und hat gemäß StVO die
Bedeutung "Gefahrstelle". Das Schild bedeutet nicht "Achtung
Gefahrstelle" oder "Achtung", sondern nur "Gefahrstelle". Es
verbietet sich daher das Gefahrzeichen zur bloßen (zeitlichen)
Ankündigungen irgendwelcher Baumaßnahmen anzuordnen. Auch im
Falle einer Sperrung von Anschlussstellen oder ganzen Autobahnen
ist das Schild fehl am Platz. Die Anwendung von Zeichen 101
beschränkt sich allein auf die Warnung vor Gefahren, die hierfür
mit einem Zusatzzeichen zu konkretisieren sind:
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
Gefahrzeichen warnen - wie der Name
schon sagt - vor Gefahren und darauf hat sich deren Anordnung zu
beschränken. |
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Die Bedeutung dieser Kombination ist
nicht "Achtung - Staugefahr", sondern "Gefahrstelle
- Staugefahr"
und tatsächlich ist hier eine "echte" Gefahrstelle
i.s.d. StVO gegeben - soweit korrekt. Der rote Rand des
Gefahrzeichens fällt allerdings wieder viel zu breit aus, das Ausrufezeichen
wurde eher ungünstig umgesetzt und der Text "Staugefahr"
verdeutlicht die Defizite der verwendeten Schriftart im
Vergleich zur vorgestellten Pixel-Schrift nach DIN 1451 Teil 2. |
|
|
| |
|
|
| |
|
Gefahrzeichen mahnen gemäß § 40 Abs.
1 StVO zu erhöhter Aufmerksamkeit, insbesondere zur Verringerung
der Geschwindigkeit im Hinblick auf eine Gefahrensituation.
Diese ist bei einem "harmlosen" Hinweis auf anstehende
Bauarbeiten oder Sperrungen von Anschlussstellen usw. nicht
gegeben und in den Regelwerken auch nicht vorgesehen. Das gilt
im übrigen auch für die Ankündigung von Umleitungen. Behörden
die eine derartige "Unterstützung" durch Gefahrzeichen anordnen
(wobei die Gefahrzeichen in diesem Kontext überhaupt nicht
anordnungsfähig sind), setzen sich nicht nur unzulässigerweise
über die StVO hinweg, sondern sie reduzieren durch den
inflationären und vor allem sachfremden Gebrauch die eigentliche
Bedeutung der Schilder.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Fotomontage: Hinweis auf
anstehende Bauarbeiten ohne sachfremde und damit unzulässige
Verwendung von Zeichen 101. Stattdessen erfolgt die Abbildung
des Sinnbildes aus Zeichen 123 (jedoch ohne rotes Dreieck)
nach dem Vorbild der Baustelleninformationstafeln - grafische
Aufwertung ohne Zeichen 101.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Beim Hinweis auf die
Bundesgartenschau hat man die Gefahrzeichen weggelassen -
es geht also.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Fotomontage: Ankündigung der
Sperrung im oberen Tafelteil (breite Anzeigefläche erforderlich)
sowie Ausweisung der Umleitung auf der Untertafel. Anstelle der
doppelten Benennung der Zielangabe "Schweinfurt" wäre auf der
Untertafel nur das Zeichen 460 (U40) und das Wort "folgen" oder
"benutzen" ausreichend, so wie hier:
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Natürlich gelingt die gezeigte
Darstellung auch nur deshalb, weil es sich um die AS Nohra
handelt - also ein Ziel mit fünf Buchstaben. Sobald die Breite
der oberen Anzeige erreicht ist wandert die Information auf
die Untertafel und um die Obertafel nicht leer zu lassen wird
dann rechtswidrig das Zeichen 101 angezeigt. Anlagen mit einer
geteilten Anzeigefläche sind für derartige Anwendungen meist
ungeeignet, insbesondere wenn die Obertafel nur 48 Pixel breit
ist.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
 Zusammenfassung
Zusammenfassung
Zunächst müssen die Verantwortlichen auf allen Ebenen die
verkehrsrechtlichen Grundlagen verinnerlichen, wobei hier
insbesondere die Dienstleistungsunternehmen für
Verkehrssicherung angesprochen sind. In diesem Zusammenhang
ergibt sich ein Änderungsbedarf der StVO (z.B.
rechtssichere Regelung der Seitenstreifenfreigabe an
Arbeitsstellen, Möglichkeit des Verzichts auf den umlaufenden
Rand bei bestimmten Wechselverkehrszeichen). Auf dieser Basis
erfolgt dann die Bearbeitung der nachgeordneten Regelwerke,
wobei insbesondere die RSA 21 und das M-TI bzw. künftig das M-tWVZ sorgfältig zu harmonisieren sind.
Harmonisieren bedeutet
dabei nicht die Anpassung der Richtlinien und Merkblätter an den
(oft unzureichenden) Stand der Technik, was in der Konsequenz
wieder nicht der StVO entspricht, sondern die Schaffung einer
einheitlichen Systematik in allen miteinander verknüpften
Regelwerken (siehe u.a. Problematik der VZ-Größe oder der Warnleuchten WL 5 und WL 7). Die StVO, die VwV-StVO und der VzKat
repräsentieren dabei stets die verkehrsrechtliche Referenz -
insbesondere was die Adaption der Verkehrszeichen an eine
LED-Anzeigefläche betrifft.
Zwingend notwendig ist eine
fachlich-technische Diskussion über Größe, Auflösung und Aufbau
der LED-Anzeigetafeln. Insbesondere zur Wiedergabe von kleinen
Sinnbildern, Verkehrszeichen auf Fahrstreifen-Pfeilen oder
Autobahn- und Bundesstraßennummern sind die bislang verfügbaren
Systeme nicht oder allenfalls bedingt geeignet. Zwar
unterscheiden sich die Anlagen in der Verkehrstechnik von den
deutlich besser auflösenden LED-Wänden in der
Veranstaltungstechnik u.a. darin, dass sie auf eine autarke
Energieversorgung angewiesen sind, dennoch ist die heutige
Auflösung von üblicherweise 48 x 48 oder 64 x 80 Pixel alles
andere als zeitgemäß.
Auch sollten nach dem Vorbild der
Veranstaltungstechnik Konzepte entwickelt werden, die eine
nahtlose Zusammenstellung modularer Segmente zur einer
individuellen Gesamtfläche ermöglichen. Nicht im Werk des
Herstellers, sondern durch die Anwender wie z.B.
Dienstleistungsunternehmen für Verkehrssicherung. Dadurch wäre
(abhängig vom verfügbaren Platz vor Ort) auch die Gestaltung
größerer Anzeigeflächen sowohl im Hoch- als auch im Querformat
möglich, so dass man eben nicht "MUC" statt München schreiben
muss.
Zweifellos besteht in den kommenden
Jahren ein großes Potential für Innovationen im
Anwendungsbereich von temporären LED-Wechselverkehrszeichen.
Aktuell beschränkt sich diese auf eine Bildwiederholfrequenz von
1000Hz, damit Kamerasysteme moderner Fahrzeuge die
LED-Verkehrszeichen auch zuverlässig erfassen können. Das ist
sicherlich sinnvoll, nützt aber am Ende nichts, wenn die
gewählte Darstellung dank 1000Hz zwar nicht mehr flackert, aber
auf Grund zu starker Abstraktion des Sinnbildes vom Fahrzeug
nicht oder falsch identifiziert wird.
Den Anfang für die gebotenen
Änderungen muss jedoch die Autobahn-GmbH machen, indem sie
bundesweit die nunmehr seit fast drei Jahren geltenden Vorgaben
der RSA 21 bezüglich einer Längenangabe unter Zeichen 274 an
Arbeitsstellen kürzerer Dauer einfordert. Der diesbezügliche
Flickenteppich steht stellvertretend für die Umsetzung von
verkehrsspezifischen Vorschriften und Regelwerken in
Deutschland: Die FGSV dokumentiert zwar fleißig die Ansprüche
des Straßen- und Verkehrswesens in hunderten verschiedenen
Regelwerken und Wissensdokumenten, aber
in der Praxis werden diese Standards viel zu oft nicht
umgesetzt.
|
|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
Grasmahd im Mittelstreifen unter
Einsatz eines LED-Vorwarnanzeigers anstelle einer fahrbaren
Absperrtafel. Ob die angezeigte Überleitungstafel angeordnet
ist?
|
|
|
| |
|
|